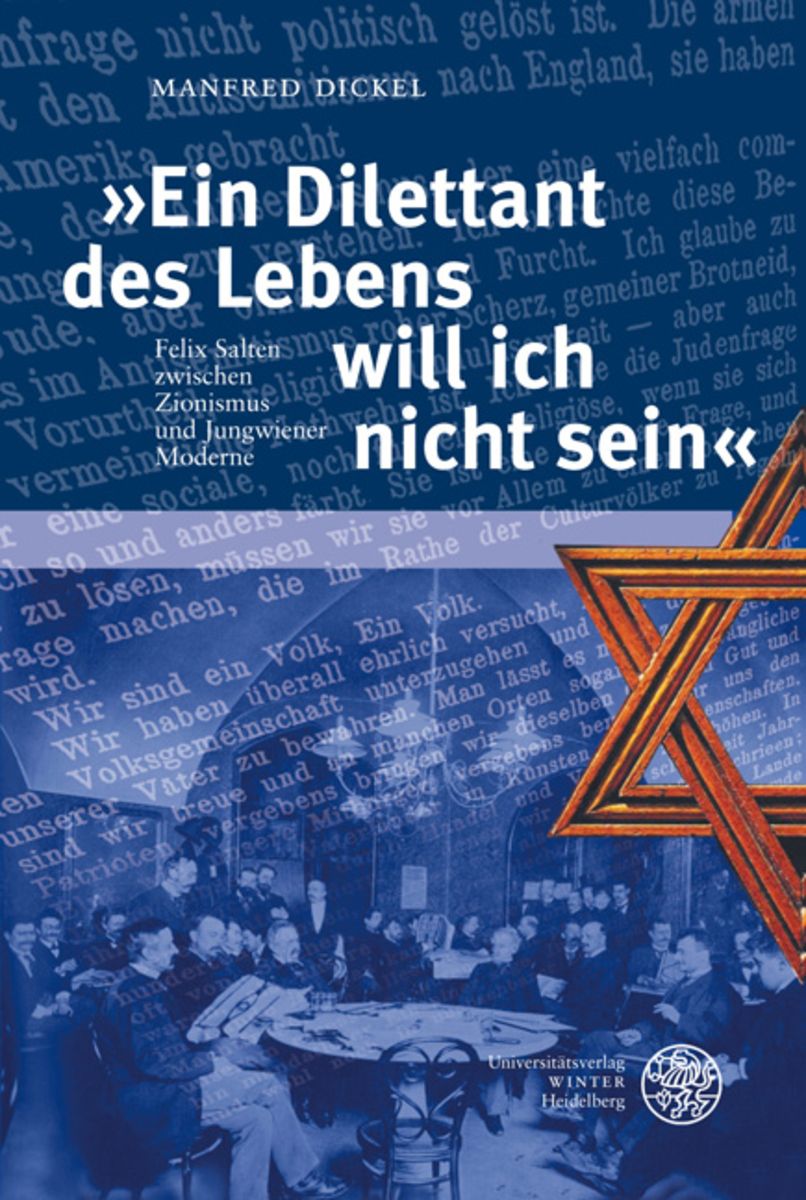In diesen enormen Verzeichnissen sind die mehr als fünftausend Feuilletons penibel registriert, die Felix Salten im Laufe seines Lebens veröffentlicht hat. Daneben verfaßte dieser Zeitungsschreiber Essays, Novellen, Romane, Theaterstücke, Operettenlibretti, Filmdrehbücher, Reiseberichte, Tierbücher, er hielt Vorträge in zionistischen Vereinigungen und war 7 Jahre hindurch Präsident des österreichischen P.E.N.-Clubs. Welch immenser Fleiß! Was trieb ihn an? Was befähigte ihn dazu? Und wie ist es möglich, daß heute von einem derart erfolgreichen Autor, wie es Salten war, fast kein Titel mehr lieferbar ist? Daß von ihm auch in jüngsten wissenschaftlichen Arbeiten noch immer falsche Angaben tradiert werden, wie zum Beispiel der Hinweis auf eine Emigration in die USA oder ein falsches Sterbejahr (1947)? Liegt dieses rasche Vergessen möglicherweise auch in der Art seiner Produktion, die in einer Fußnote des vorliegenden Buches als „journalistische Schriftstellerei“ bezeichnet ist, begründet? Manfred Dickel hat in einer monographischen Arbeit, die zunächst 2002 als Dissertation an der Universität Jena angenommen wurde und die er nun in einer auf 500 Seiten kondensierten Druckfassung publiziert hat, einen Antwortversuch unternommen.
Dickel macht auf die tiefen Demütigungen in Saltens Kindheit aufmerksam: der Vater verliert durch Fehlspekulationen das gesamte Vermögen, die Familie muß aus gutbürgerlichen Verhältnissen, der großen Wohnung mit Personal im 9. Bezirk, in die Beengtheit eines Zinshauses in Währing („vor der Linie“) ziehen, dazu kommen frühe antisemitische Pöbeleien im Gymnasium in Hernals und das Trauma einer abgebrochenen Schulkarriere.
Aus einem grenzenlosen Kompensationsbedürfnis erwächst offenbar auch jene Kraft und Willensstärke, die Beobachter immer wieder an Salten konstatiert haben. In einem zweiten wesentlichen thematischen Strang legt Dickels Buch zahlreiche Hinweise auf Saltens Selbstverständnis als Jude frei: Sein Engagement als Zionist, das ihn bald schon vom glühenden Bewunderer Theodor Herzls zu dessen propagandistischem Nachfolger werden ließ, die Konterbande, die er in seinen Artikeln in die liberalen Blätter, namentlich die „Neue Freie Presse“, einschmuggelt bis zu seinem Palästinabuch von 1925 („Neue Menschen auf alter Erde“). Schließlich bemüht sich der Autor um eine ausgewogene Darstellung der Ereignisse rund um den P.E.N.-Kongreß in Ragusa 1933, die bis heute Saltens Bild verdunkeln, weil ihm eine allzu lasche Haltung gegenüber den Nationalsozialisten vorgeworfen wird.
Auf die beiden erfolgreichsten Salten-Titel „Bambi“ und „Josefine Mutzenbacher“ geht Dickel überhaupt nicht ein, sie sind auch lediglich auf dem hinteren Einbanddeckel erwähnt. Dabei ließe sich zum letzteren Buch immerhin bemerken, daß die Diskussion über Saltens Autorschaft immer wieder neu aufflammt und daß es nicht ohne Komik ist, daß Saltens Erben zunächst einen Ehrenbeleidigungsprozeß anstrengten, um den Namen Salten vom Makel eines pornographischen Autors zu reinigen und ein paar Jahre später in einem neuen Verfahren um Autorschaft und Tantiemen stritten. Beides erfolglos, notabene. Dickel hat eine beeindruckende Fülle von Quellen ausgewertet, nicht nur in den zeitgenössischen Tageszeitungen, sondern er hat auch in großem Ausmaß Erinnerungen, Tagebücher und Briefe herangezogen, die die beschriebene Epoche abdecken.
Reden wir aber auch von den Mängeln des Buches. Es gibt eine Reihe sachlicher Irrtümer: Herzls Sterbeort ist nicht Toblach, der Schriftsteller Henckell hieß nicht Kurt, der Schauspieler Sonnenthal nicht Josef, Heinrich Benedikt war nicht Arzt, Alfred Grünfeld nicht Schauspieler, Ernst Lothar nicht Kunsthistoriker. Dann gibt es mangelhafte Textwiedergaben: weder ist in „Wurstelprater“ von den „Schrammerln“ die Rede noch lautet der gemütliche Wienerische Slogan in „Das österreichische Antlitz“: „Beim Gschwandner, Stalehner“ da lernt man sie kehner…“ Derlei Flüchtigkeiten säen Mißtrauen in die Zuverlässigkeit der Zitate. Ganz allgemein: der Stil des Buchs ist nicht gerade mitreißend. Es gibt schiefe grammatische Konstruktionen, wunderlich wuchernde Wissenschaftsprosa („Die sich überbietende Mängelkonstitution als Standarddiagnose erlaubt freilich soviel zelebritären Anspruch wie obstruktiven Dispens.“ Wie bitte?), bisweilen wirkt auch Saltens blumiger Feuilletonstil durch die extensive Metaphernlust des Monographen gedoppelt. („Das drastisch formulierte Sentiment schlägt an den Hohlkörper einer antimetaphysischen Weltbetrachtung oder, ließe sich in einem anderen Bild sagen, reißt an einer Saite, deren Schwingungen tonlos bleiben und den Schrecken gerade deshalb steigern.“) Manchmal sind die Bilder schlicht unfreiwillig komisch („12 Jahre später war die Welt wieder ein gutes Stück weiter gerollt.“ „Jetzt, 1919, wo der Judenhass, kaum dass der Krieg vorbei ist, immer ungeniertere Blüten treibt.“).
All dies eingeräumt, bleibt diese ambitionierte Studie dennoch eine gerecht zu würdigende Leistung. Sie stellt eine der einflußreichsten Erscheinungen der österreichischen Literatur zwischen 1890 und 1938 überzeugend in ihren psycho-sozialen Kontext. Sie bietet ein sehr differenziertes Deutungsmuster für Saltens Motive und für seine Wirkung. Sie gibt einem brillanten Vertreter des österreichischen Feuilletonismus seinen Glanz zurück und verleiht einer Persönlichkeit, die auch für Zeitgenossen oft nur schwer zu fassen war, Kontur. Noch ein Detail aus der eingangs erwähnten Ausstellung bleibt in Erinnerung: die von Salten verwendeten Lesezeichen, geschmückt mit dem eigenen Porträt.