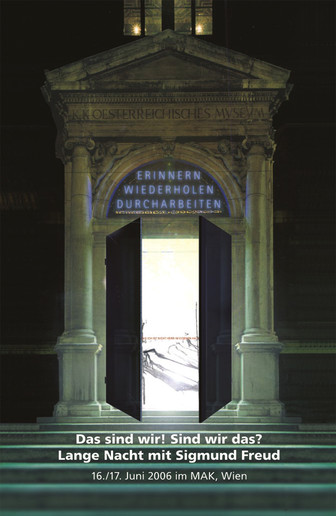In dem Band (der sich von diesem Satz eher fern hält) findet sich einiges Belanglose, das nahelegt, dass freies Assoziieren unter dem Zeltdach kultureller events nicht immer zum Kern der Sache kommt – die Devise heißt, dass in der Nacht jeder sich mit seinem Freud vergnügen dürfe. Doch Urbach montiert die obligatorischen Festredenpartikel geschickt mit abgründigen Zitaten aus Freuds Werken und Briefen, mit Gedichten von Kurt Tucholsky bis W. H. Auden, mit Prosastücken von Nabokov, Kraus, Schnitzler und Broch, und darunter gibt es auch überraschende Funde wie jenes schlesische Volkslied vom dicken Regenwurm, das sich aufs schönste mit Eduard Mörikes „Erstes Liebeslied eines jungen Mädchens“ verträgt.
Ernster wird es mit zwei Publikationen, die sich nicht mit einer Nacht zufrieden geben, sondern es mit dem ganzen Freud oder wenigstens mit Freud und der „Wiener Moderne“ aufnehmen wollen.
Im Metzler-Verlag ist nun, im Schatten seines 150. Geburtstags, ein veritables Freud-Handbuch erschienen. Um so notwendiger war dies, als die Wirkungsgeschichte der Psychoanalyse, auch jenseits der Klinik, sich weit aufgefächert hat in eine Vielzahl von wissenschaftlichen Disziplinen und gesellschaftlichen Bereichen, und damit das weite Feld der Konfrontationen, Annäherungen, Abstoßungen und Transformationen auch von Universalisten kaum mehr überschaubar ist. Am Anfang steht aber die Irritation, denn prüft man Titel und Inhalt, wird man schnell feststellen, dass doch falsche Erwartungen geweckt werden. Denn der ganze Freud ist es nicht, den Hans Martin Lohmann, ehemaliger Chefredakteur der Zeitschrift „Psyche“, und Johannes Pfeiffer, Professor für Neuere deutsche Literatur an der Pädagogischen Hochschule Freiburg, hier vorstellen. Es ist nämlich erst der vierzigjährige Wissenschaftler, der hier in den Blick rückt, und der hat bis dahin schon etwa 160 Artikel veröffentlicht (von denen eben einmal zwei wiederaufgelegt worden sind, über Kokain und Aphasie; und nur diese sind es, die hier im Band vorgestellt werden).
Überhaupt ist es schwer begreiflich, dass angesichts der überragenden Bedeutung Freuds und trotz einer inzwischen über hundertjährigen Rezeptionsgeschichte im S.Fischer-Verlag oder anderswo immer noch keine wissenschaftliche Edition der Werke der „naturwissenschaftlichen Periode“ in Angriff genommen wurde. Auch von der öfters angekündigten historisch-kritischen Gesamtausgabe ist noch nichts in Sicht. Wäre das bei Autoren wie Charles Darwin, Karl Marx, Friedrich Nietzsche oder Max Weber vorstellbar? Und ist nicht dies der von den Festreden zugedeckte Skandal des Freud-Jahres? Es ist wohl ungerecht, diese wissenschaftspolitische und verlegerische Misere gerade bei dem Freud-Handbuch zu artikulieren. Ilse Grubrich-Simitis pointiert selbst die Misere im Handbuch: Solange die im Londoner Exil entstandene Edition von Freuds Werken die umfassendste deutsche Ausgabe sei, solange „ist der Autor Sigmund Freud gleichsam nicht aus dem Exil heimgekehrt“ (S. 282).
Es ist also der psychoanalytische Freud, den das Handbuch beleuchtet (aber unpsychoanalytisch ist gewiss die Ausklammerung der Frühzeit), und das Vorwort weist dann hin auf eine weitere Einschränkung, denn die klinischen, therapiebezogenen Aspekte des Werks bleiben im Hintergrund zugunsten des kulturhistorischen und kulturtheoretischen Panoramas, das auf das wachsende Interesse der Kulturwissenschaften an der Psychoanalyse reagiert.
Das Buch teilt seinen Stoff ein in vier quantitativ ungleichgewichtige Abteilungen. Die erste, „Freud und seine Epoche“, umfaßt fünf umfangreichere Artikel, die zweite und größte Abteilung, „Werke und Werkgruppen“, beinhaltet 39 relativ knappe Artikel, die dritte Abteilung, „Themen und Motive“, ist aufgeteilt in sechs größere Artikel, die von Freuds Kulturbegriff bis zu dem Komplex „Theater, Szene und Spiel“ reichen, und die letzte große Abteilung, die der „Rezeptions- und Wirkungsgeschichte“ gilt, umfaßt schließlich 18 Artikel, von denen einige wiederum aufgefächert sind. Diese insgesamt 68 Artikel sind nicht nur im Blick auf den Umfang, sondern auch in ihrem Charakter recht unterschiedlich, weil sich einige stärker an der Idee eines enzyklopädischen Handbuchs orientieren, andere sich eher der Form eines Essays annähern. Und es ist die Crux jedes Handbuchs, dass der Leser dort, wo er zuhause ist, auf Vertrautes stoßen wird, und anderswo dagegen Neuland betreten und Impulse gewinnen kann – so beginnt der vorliegende Band mit einer Skizze, die den Epochenkontext umreißt (auf neun Seiten eine Spanne von etwa 80 Jahren), die eher vertrauten Spuren folgt, während ein späterer Artikel (von Konstanze Fliedl) über die Wiener literarische Moderne selbst für geschultere Leser durchaus überraschende Akzente setzt. Die Mehrzahl der Artikel sind nicht nur informativ und berücksichtigen aktuelle Forschungen und Debatten, sondern sie bereiten auch Lesevergnügen. Das ist für ein so gewichtiges Handbuch nicht wenig. Mit seinen heterogenen Artikeln hat es einen hohen Gebrauchswert, und dem steht nicht entgegen, dass sein Charakter stärker der eines Lesebuchs als eines Nachschlagewerks zu sein scheint.
Der Rahmen des Buches ist einerseits weit gespannt, nämlich vom Epochenkontext bis zur Rezeption der Psychoanalyse in Feminismus und den Gender Studies oder den Kinotheorien der Gegenwart, andererseits – wie erwähnt – eng, weil die klinischen Schriften und die sogenannte „vorpsychoanalytische Periode“ Freuds, die knapp zwei Jahrzehnte umfasst, am Rand bleiben. Auch über Freuds Konflikte mit der Wiener Universität erfahren wir wenig, und das Wenige bleibt ungenau. Überhaupt mag man an manchen Stellen eine zu große Nähe zum Thema monieren. Dass Freud mit seiner aus Paris mitgebrachten Überzeugung, dass Hysterie auch bei Männern aufträte, in Wien „auf einhellige Ablehnung“ stieß (S. 54), gehört zu den hier weiterkolportierten psychoanalytischen Gründungslegenden, die sich schon durch einen Blick in Arthur Schnitzlers medizinische Schriften (in der Edition von Horst Thomé) relativieren ließen (Bericht der „Wiener Mediz. Presse“ über die Sitzung der K.u. k. Gesellsch. der Ärzte in Wien vom 15. Okt. 1886).
Manchmal werden auch autobiographische Konstruktionen Freuds umstandslos als Fakten wiedergegeben (etwa, dass ihn die Lektüre des Goethe zugeschriebenen Stückes „Über die Natur“ zum „Studium der Natur“ geführt habe). So hilfreich die konzisen Darstellungen von Freuds Werken im dritten Teil des Bandes sind, so erscheint dem Rezensenten doch der letzte Teil, der in 15 Abschnitten die Rezeption und Diskussion der Psychoanalyse in verschiedenen Disziplinen und Fächern darstellt und damit die breite Wirkungsgeschichte der Psychoanalyse auch jenseits der Klinik dokumentiert, von besonderer Bedeutung. Hier sind, dank einer Vielzahl von Autoren, die Linien aus dem 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart gezogen (ohne das denkbare Wunschbild eines stetig wachsenden Einflusses der Psychoanalyse zu etablieren), was am Ende ein dezentriertes Mosaik liefert, in dem sich die Kulturgeschichte der Neuzeit spiegelt. Je länger man sich mit dem Sammelwerk, an dem 42 Autoren mitgewirkt haben, beschäftigt, desto sinnfälliger wird doch die kluge architektonische Struktur des Buches und seine konzertante Vielstimmigkeit, mit der das widersprüchliche Werk Freuds reflektiert wird.
Ein zweites, schmaleres Handbuch, herausgegeben von Thomas Anz und Oliver Pfohlmann, widmet sich dem Komplex von „Psychoanalyse in der literarischen Moderne“. „Die Literatur des gesamten Jahrhunderts ist ohne ihre Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse kaum angemessen zu verstehen“, schreiben die Herausgeber im Vorwort des vorliegenden Bandes. Es ist der erste einer auf fünf Bände konzipierten Reihe, in welcher diese Auseinandersetzung dokumentiert werden soll. Eine fünfbändige Reihe, das klingt beeindruckend, ist aber dennoch eher ein bescheidenes Projekt, denn es beschränkt sich, dem Rahmen Marburger Forschungsprojekts „Psychoanalyse in der literarischen Moderne“ entsprechend, erstens auf die deutschsprachige Literatur (das heißt beispielsweise: kein Bloomsbury, kein James Joyce und kein D. H. Lawrence), und es dokumentiert zweitens nur „die üblichen Verdächtigen“ (vom dritten Band abgesehen, der den Schriftstellerinnen gewidmet ist), denn da fehlt beispielsweise der alte Johannes R. Becher, der während einer Entziehungskur eine psychoanalytische Ausbildung begonnen hatte und sein Fachwissen auch noch im Moskauer Exil „dokumentierte“, da fehlen Salomon Friedländer (Mynona), Leonhard Frank, Otto Weininger oder Otto Soyka, da fehlt auch die große und bislang kaum erschlossene Riege von Literaten, die zum Kreis um Freud gehörten: Hanns Sachs, Georg Groddeck und Fritz Wittels, die als Romanautoren reussierten, da bleibt die kaum weniger interessante Wirkung von Freuds Schriften auf die sog. Unterhaltungsliteratur ausgeschlossen (etwa auf Norbert Jacques, dessen Dr. Mabuse sich als Psychoanalytiker präsentiert) und schließlich hat man in der Dokumentation, weil das Material nur schwer eingrenzbar ist, auf die Spuren der Psychoanalyse in den literarischen Werken selbst (von wenigen Ausnahmen abgesehen) verzichtet.
Aber der vorliegende erste Band bündelt doch eine erstaunliche Materialfülle, die man bislang höchst mühselig sich zusammen suchen mußte. Nach einem einleitenden Essay von Thomas Anz (von dem man Teile schon aus dem Freud-Handbuch kannte) und einem kleineren Essay von Oliver Pfohlmann zur sogenannten Wiener Moderne folgen vier Kapitel, in denen aus dem Werk von Hermann Bahr, Hugo von Hofmannsthal, Arthur Schnitzler und Karl Kraus Passagen ausgewählt und kommentiert werden, die sich auf Psychoanalyse und Freud beziehen. Die Dokumente sind in chronologischer Folge und in der Regel nach der Fassung der Erstdrucke abgedruckt, die Kommentare sind so knapp wie erleuchtend, und hilfreich sind auch die weiterführenden bibliographischen Hinweise zu den einzelnen Autoren. Freilich kann man ein Unbehagen nicht unterdrücken, dass nämlich die „Wiener Moderne“ auf vier Namen reduziert wurde.
Unter der web-Adresse www.literatur-psychoanalyse.de (die zum Zeitpunkt der Niederschrift der Rezension noch nicht einsehbar war), soll das Projekt detailliert dargestellt werden, dort soll auch der Ort für Ergänzungen, Korrekturen und Aktualisierungen sein. Die Herausgeber rufen nachdrücklich dazu auf, dorthin „Ergänzungsbedürftiges oder Fehler“ zu melden. Dass Freuds Schüler oder Partner wie Sachs, Groddeck und Wittels vorerst fehlen, ist deshalb bedauerlich, weil mit ihrer Romanproduktion deutlich würde, welches komplexe Wechselspiel von Psychoanalyse und Literatur nach 1900 beginnt. Man kann dabei zwei Erzählungen verfolgen, von denen die erste im vorliegenden Band größeres Gewicht bekommt, nämlich die Erzählung vom ungeheuren Einfluss der Psychoanalyse auf die Literatur ihrer Zeit. Die andere, konkurrierende Erzählung, verweist darauf, dass Freud zwar ein Kenner und Liebhaber der Literatur war – in seiner Traumdeutung nennt er sich einen „Bücherwurm, dessen Lieblingsspeise die Bücher sind“ -, aber zur Wiener Moderne wie später zum Expressionismus oder Surrealismus bekanntermaßen entschiedene Distanz bewahrte, obwohl ihn von dorther manche Liebeserklärung erreichte. Es geht also um mehr als um eine simple Einflussgeschichte.
Vor allem wehrten sich die Wiener Autoren gegen den Prioritätsanspruch der Psychoanalyse, und die Einsprüche von Hofmannsthal, Schnitzler und Kraus lassen sich hier im Detail nachlesen. Psychoanalyse erkläre nur das, was die Literatur ohnehin längst gewußt habe, notiert Hofmannsthal, und ähnlich sagt es Schnitzler. Später hatte Thomas Mann in seiner Geburtstagsrede von 1936 die Psychoanalyse vorsorglich der spätromantischen Literatur subsumiert. Die Belege für einen Einfluss der Psychoanalyse können also auch für die Nähe des literarischen Komplexes der Psychoanalyse zeugen, für die Nähe von Entdecken und Wiedererkennen. Es geht also um problematische Notizen, da die Neigung der Schriftsteller, einen starken Einfluss zu leugnen, nahe liegend und im Falle Thomas Mann belegt ist, man aber auch auf das Gegenteil stößt, dass nämlich ein Autor sich aktueller Schlagworte bediente, oder dass ein poetisches „Fehllesen“ stattfand und der Autor sich so einen imaginativen Raum schuf.
Zwar gehörten Hofmannsthal wie Schnitzler zu den frühen Lesern der Traumdeutung, aber ein eindeutiges Bekenntnis zu Freud hat, vom frühen Karl Kraus abgesehen, aus dem Kreis der Wiener Dichter niemand gegeben. Der vorliegende Band liefert jedenfalls das Material und eine Fülle von Anregungen, um diesem Wechselspiel im Detail nachzugehen.