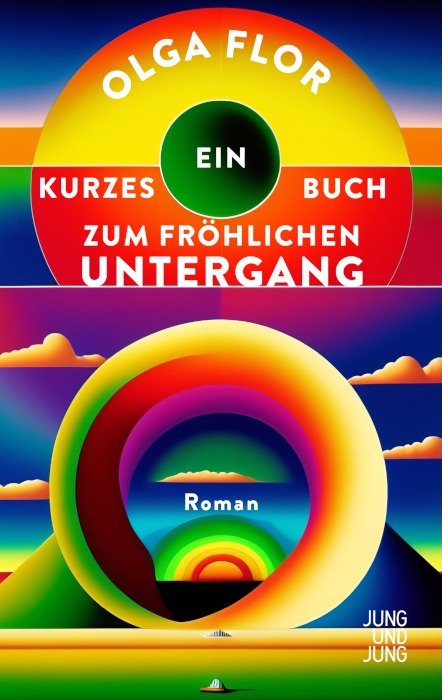Das Wort „Kipppunkt“ hört man seit einigen Jahren häufig in Zusammenhang mit dem Klimawandel. Er bezeichnet das Erreichen eines kritischen Schwellenwerts der Erderwärmung, ab dem schon geringste weitere Störungen sowie selbstverstärkende Rückkoppelungen eine Änderung des Klimas nach sich ziehen, die unumkehrbar wird und die (Lebens)Bedingungen auf unserem Planeten grundlegend verändert.
Davon erzählt Olga Flor in ihrem dystopischen Roman, der einen direkten Bezug auch zu anderen Themen unserer Zeit spannt wie Neoliberalismus und Profitgier, Verschwörungstheorien und autoritäre Tendenzen. Die Autorin nimmt das Wort „Kipppunkt“ wörtlich und lässt die Drehachse der Erde und damit unseren Planeten kippen. Diese Achse entspricht einer gedachten Linie zwischen Süd- und Nordpol und steht im Weltall nicht senkrecht zur Ebene, auf der unser Planet um die Sonne kreist, sondern schief. Ursache der Neigung der Rotationsachse war ein Asteroid, der den noch jungen Planeten traf und dabei Material herausschlug, aus dem wiederum unser Mond entstand. Der Neigungswinkel der Erdachse unterliegt nur geringen Veränderungen, denn die Anziehungskraft des Mondes hält ihn relativ stabil und verhindert, dass die Gravitationskräfte der Sonne oder der Planeten Jupiter und Saturn den Neigungswinkel stärker schwanken und unseren Globus vielleicht sogar kippen lassen.
Folgen dieser Neigung sind die Jahreszeiten und unser Klima, da die Energie der Sonnenstrahlen nicht gleichmäßig auf die Erde trifft. Auch die unterschiedlichen Tages- und Nachtlängen sind davon bestimmt. Wissenschaftler:innen diskutieren, ob und wie der Klimawandel den Neigungswinkel der Erdachse möglicherweise beeinflussen wird. Sollte es beispielsweise durch das Abschmelzen der polaren Eisflächen und die vermehrte Entnahme von Grundwasser zu Masseverschiebungen kommen, könnte dies zu einer stärkeren Neigung der Erde führen.
Flor entwickelt dieses Szenario weiter. In ihrem Roman wird der Kipppunkt für die Erde überschritten. Ursache des Kippens ist keine Veränderung der Wasserverteilung oder die nachlassende Anziehungskraft des Mondes. Olga Flor setzt beim Herausschlagen von Material und damit einhergehenden Masseverschiebungen an, verursacht nicht durch einen Asteroiden wie in den Anfängen der Erdentstehung, sondern durch exzessive Ausbeutung von Gas- und Ölvorkommen sowie anderen Bodenschätze. Das Kippen setzt allmählich ein und wird zu einem „immer schneller sich selbst verstärkenden Prozess“, (S. 9) der in die Katastrophe führt. Die „Erde war einfach umgefallen“, (S. 10) heißt es lapidar. Es ist keine überraschende Entwicklung. Schon der erste Satz des Romans weist darauf hin: „Wir haben es kommen sehen, es war uns egal.“ (S. 7)
Nach dem Kippen bleibt die Erdatmosphäre zwar erhalten und ermöglicht menschliches Leben, aber die Bedingungen werden rasch unwirtlich. Die Erdhalbkugeln liegen je ein halbes Jahr im Dunklen, die Tag-Nachtgrenze verschiebt sich täglich, während der Mond weiterhin die Erde umkreist, aber in anderen Winkeln. Stürme toben, die nicht nur das Meer aufpeitschen, Hochwässer folgen auf lange Trockenperioden mit verheerenden Bränden, ein Vulkan bricht aus. Die Menschen fliehen, das Notwendigste mit sich schleppend, aus der Dunkelheit Richtung Äquator, während staatliche Strukturen sich auflösen und anarchische Zustände einreißen. Denn bewaffnete Drohnen und verschiedene Banden machen Leben und Alltag unsicher.
Es bilden sich Verschwörungssekten mit zahlreichen Splittergruppen, auch einige Solidargemeinschaften. So entstehen mehrere Gruppen, welche die Unwucht der Erde durch gezielte Masseverlagerung ausgleichen und den Planeten so wieder ins Lot bringen wollen. Aber nicht einmal die eingetretene Katastrophe lässt diejenigen innehalten, die – nach wie vor von Wachstumsfantasien getrieben – nach Möglichkeiten der Gewinnmaximierung suchen oder nach innovativen Betätigungsfeldern wie der Besiedelung des Monds.
Doch wie kann das Leben nach einer Apokalypse überhaupt weitergehen, wie die eigene Existenz gesichert werden, wenn das Recht des Stärkeren gilt, man Veränderungen der Natur und anderen Menschen hilflos ausgeliefert und nichts von Dauer ist? Ist es riskanter, für sich allein, dafür autonom zu bleiben? Oder erhöht zu zweit zu sein „mittelfristig die Überlebenschancen“? (S. 38) Und „was ist freier Wille, wenn rundherum die Welt untergeht“. (S. 102)
Drei starke, lebenstüchtige Frauen stehen für mögliche Wege, durch das Chaos zu kommen. Hauptfigur ist die frisch geschiedene Armanda, was übersetzt die Bewaffnete, aber auch die sich Wappnende bedeutet. Bewaffnet ist sie nur mit zwei Messern, die ihr bei der Begegnung mit einer rabiaten Gang, bei der sie schwer verletzt wird, allerdings nichts nützen. Die 47-jährige will auf sich allein gestellt und völlig autonom sein. Da sie analytisch denkt und lebenspraktisch veranlagt ist, wappnet sie sich auf ihrer Flucht mit tragbaren Solarzellen, um Strom erzeugen zu können, sowie mit mitgebrachten Dingen und Fundstücken, mit denen sie handeln kann.
Getrieben wird Armanda von der Sorge um ihre technikgläubige Tochter Nora, von der sie nicht weiß, wo sie sich aufhält. Sie macht sich auf die Suche nach Nora, was angesichts der Katastrophe kein leichtes Unterfangen ist. Auf ihrer langen Reise wird sie begleitet von einem Oktopus, mit dem sie spricht und um dessen Wohlergehen sie sich sorgt. Sie wandert meist entlang der Tag-Nacht-Grenze, weil sie Licht braucht, führt „ein Leben auf dem Boden und im Dreck“ (S. 97), lernt Erdhöhlen zu graben, die im Schlaf ein wenig Schutz bieten, oder ruht sich in Höhlen aus. Am liebsten ist sie nahe an einem Gewässer, vor allem am Meer, das im Roman beinahe zu einer eigenen, mächtigen Figur wird.
Nora hingegen ist Teil eines subterran arbeitenden Forschungsteams, das mit Freiwilligen an der Möglichkeit der „Winterschlafinduktion bei nichthibernierenden Spezies“ (S. 36) forscht, um Extrembedingungen auf der Erde eine Weile überstehen zu können. Nicht alle überleben die Experimente, manche tragen Hirn- und andere Organschäden davon. Auch Nora stellt sich als Versuchsperson für eine Studie zur Verfügung. Ungeplant wird sie schwanger, bringt eine Tochter zur Welt, bei deren Geburt ihr Armanda beisteht. Doch sie plant bereits eine weitere Testreihe, bei der ein Baby bloß hinderlich wäre. Und so wird die Großmutter einspringen und die Betreuung des neuen Lebens eine Zeit lang übernehmen.
Die dritte ist Sedna, eine Antipodin zu Armanda. Sie ist die Sesshafte, einerseits selbständig, flexibel und lernbereit, wenn sie sich in der postapokalyptischen Welt als Farmerin neu erfindet, indem sie mit vorhandenen Rohstoffen eine unterirdische Pilzzucht anlegt. Andererseits ist sie die Sorgende, die Armanda vorübergehend Obdach gewährt, sie verarztet und zur Ruhe kommen lässt. Die beiden gehen eine Geschäftsbeziehung ein, denn Armanda will mit Sednas Pilzen handeln. Angedeutet wird, dass sie sich auch als einander Begehrende begegnen, um für Momente des Beisammenseins „diese ganze unerfreuliche Gegenwart mit ihren unhabitablen Habitaten hinter sich lassen [zu] können.“ (S. 79)
Der wandlungsfähige Oktopus wiederum scheint am schnellsten mit den neuen Bedingungen zurechtzukommen. Er verlässt das Meer, weil ihm dort neue Gefahren drohen. So lebt er nun auch im Süßwasser, kann die Farbe und Musterung seines Äußeren an die Umgebung anpassen und geht eine Symbiose mit Flechten ein, die ihn vor Austrocknung schützen. Zudem verfügt er über ein außergewöhnliche Regenerationsfähigkeit, weil er zwei seiner von Banden abgehackten Arme einfach nachwachsen lassen kann.
Neben dem packenden Inhalt ist es vor allem die Form des knapp 160 Seiten umfassenden Romans, die in Bann zieht, vor allem dessen überzeugende Erzählökonomie. Die Handlung ist dicht und sehr präzis vorangetrieben, dabei nie bis ins letzte Detail ausgeführt, sondern es bleiben Leerstellen, die Leser:innen mit der eigenen Phantasie ausmalen können. Der Ton der Erzählung ist nüchtern, reduziert und klar, was sich schon in den Titeln der meist kurzen Kapitel zeigt, die oft nur aus einem Nomen bestehen, gelegentlich ergänzt mit dem bestimmten Artikel.
Liest man erstmals den Titel des Romans, ist man vielleicht irritiert. Denn was kann an einem Untergang schon fröhlich sein? Doch Olga Flor zeigt hier viele Nuancen von fein austariertem Humor, der vom lakonischen, gelegentlich bösen oder am Absurden streifenden Witz über leise Ironie und Schalk bis hin zum Sarkasmus reicht und gelegentlich an Johann Nestroy denken lässt. In diesem Schlingern durch und über viele Abgründe gibt es zudem Anklänge und anverwandelte Zitate, die an andere Literaturen erinnern, etwa Dantes Inferno, die Genesis, den Prolog des Johannes-Evangeliums oder Gertrude Steins Gedichte – ein faszinierendes Lesevergnügen!
Monika Vasik, geb. 1960, Studium der Medizin an der Universität Wien, Promotion 1986; Lyrikerin, Rezensentin, Ärztin; Literaturpreise u. a. Lise-Meitner-Preis 2003, Publikumspreis beim Feldkircher Lyrikpreis 2020; Mitbegründerin und bis 2022 Mitverantwortliche der Poesiegalerie; mehrere Lyrikbände, zuletzt: hochgestimmt (Elif Verlag, 2019) und Knochenblüten (Elif Verlag, 2022). www.monikavasik.com