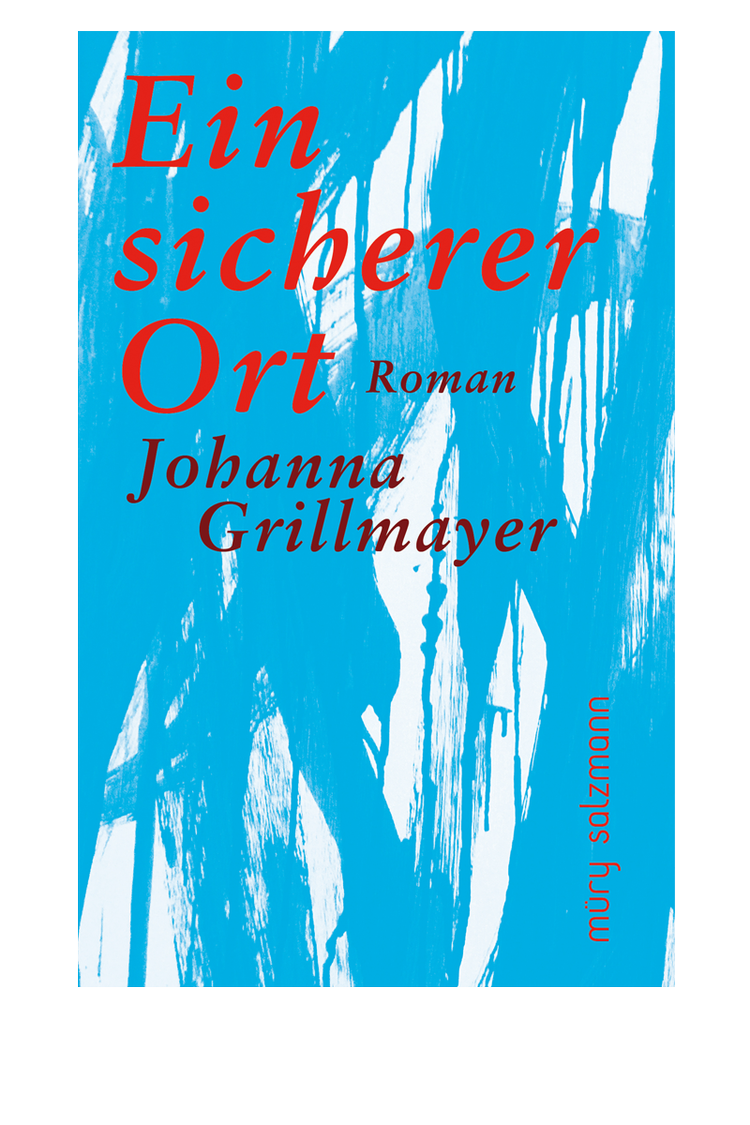„Die Stadt um sie herum atmete nicht. Leblos lagen die Straßen da, die Fensterscheiben, stumpf vor Staub, glänzten nicht im Sonnenlicht; nichts regte sich.“ (S. 21). Es ist ein ernüchterndes Erlebnis für das Vierer-Gespann Jola, Marek, Em und Tom, als sie in Wien ankommen – was von der stolzen Stadt geblieben ist, sind nur noch stumme Zeugen einer einst prachtvollen Umgebung; die wenigen Menschen, auf die sie stoßen, sind vereinsamt und in der Einöde wunderlich bis gefährlich geworden.
Ein sicherer Ort, der zweite Teil der Buchreihe von Johanna Grillmayer, setzt auf einer der beiden Zeitebenen des Plots dort ein, wo That’s Life in Dystopia aufgehört hatte: Von Neugier getrieben, macht sich eine kleine Abordnung auf den Weg vom Hotel Sonnenhof, wo sich eine bunt zusammengewürfelte Gemeinschaft rund um die willensstarke Jola gefunden und miteinander gut eingerichtet hat, in die ehemalige Hauptstadt. Zehn Jahre sind vergangen seit dem nicht näher definierten „Ereignis“, das den Großteil der Menschheit ausgelöscht hat. Nach ein paar Tagen in Wien, die sowohl kulturell als auch zwischenmenschlich ernüchternd sind, muss die Expeditionstruppe einsehen, dass von dem Ausflug keine tieferen Erkenntnisse zu erwarten sind – und dass es wohl das Beste ist, den angestammten Sonnenhof zu verlassen und stattdessen in ein Dorf im Burgenland zu ziehen, wo sich einige andere Familien niedergelassen haben, wo auch Em mit ihrer Freundin, ihrem Bruder und dessen Familie lebt. Dort gibt es nicht nur Anschluss an eine Gemeinschaft, sondern auch eine Schule für die Kinder und vieles mehr.
Auf einer zweiten Zeitebene begegnet man der Wahlfamilie Jola, Jakob, Marek, Ali, Gabriel, Boris, Alex und den Kindern, die sie alle miteinander haben, sieben Jahre später wieder. Viel ist passiert in der Zwischenzeit, Jola ist zum sechsten Mal schwanger, die Kinderschar ist deutlich angewachsen und die Erwachsenen stellen mal mit einem Seufzen, mal fast mit Erleichterung fest, dass sie nicht mehr die Jüngsten sind. Doch während in das eng verwobene Beziehungsgeflecht der nun langsam in ihren Vierzigern ankommenden Elterngeneration allmählich Ruhe und die Sehnsucht nach Beständigkeit einzieht, tauchen neue Herausforderungen auf: Die Kinder werden allmählich flügge, die Mädchen, die allmählich zu jungen Frauen heranwachsen, sehen sich mit den Begehrlichkeiten von Gemeinschaften wie den „Pferdemännern“ von einem nahen Hof konfrontiert, und kurzfristig sieht es sogar danach aus, als sei eine von ihnen schwanger – was sogar Jola, die selbst in einer sehr offenen Familienkonstellation lebt, doch kurz aus der Fassung bringt. Denn eine sichere Abtreibung ist keine Option, auch wird Geburten grundsätzlich mit leichtem Bangen entgegengesehen.
Die wirklichen Probleme entzünden sich also am Gegenüber, an anderen Menschen – so auch im Dorf, in dem die „Bigamisten“, wie Jolas Truppe genannt wird, kritisch beäugt werden. Bei einer Sitzung kommt es zum ersten Schlagabtausch, bei dem Maria, eine der Dorfbewohnerinnen, Jola schwere Vorwürfe macht: „Wir kennen uns nicht, sagte Maria. Aber ich muss dir sagen, du kannst nicht in der Gegen herumballern, es gibt hier Kinder, deren Leben du damit aufs Spiel setzt.“ (S. 104). Der Haussegen hängt also gewaltig schief und wird zusätzlich belastet, als es bei einer Begegnung zwischen Jola, Boris, Lennart und Sepp vom Pferdehof zu einer Auseinandersetzung kommt – und einige Zeit später Boris, der die Schulkinder nach Hause begleiten soll, nicht nach Hause zurückkehrt. In einer waghalsigen Aktion befreit Jola mit ihren halbwüchsigen Töchtern den schwer verletzten Freund, der in einer Racheaktion von Sepp und Roman von den „Pferdemännern“ verprügelt wurde, und macht sich damit auch in ihrer eigenen Truppe keine Freunde. Unverantwortlich sei das, die Mädchen so in Gefahr zu bringen, befindet selbst Jakob ungläubig, einer ihrer Lebensgefährten. Viel schwerer aber wiegt die Frage: Wie sühnt man die Tat ohne gültige Gesetzgebung? „Gewalt braucht ein Monopol. Und eine Exekutive. Aber so weit sind wir einfach noch nicht“, gibt Em zu bedenken (S. 129), als Jola aufgebracht Konsequenzen für die Gewalttat fordert.
Es ist Johanna Grillmayer hoch anzurechnen, mit welcher Ruhe und Bedachtheit sie ihre Figuren durch ein Meer an ethischen Fragestellungen und grundsätzlichen Bewegtheiten des Menschseins navigiert, und das in einer schmerzhaft realistisch anmutenden Welt, in der alles, was einst sicher schien, neu erstritten und ausverhandelt werden muss. Dabei gelingt ihr eine beeindruckend stringente Charakterentwicklung für all ihre Akteur:innen und ein ebenso plausibles Weiterdenken der Beziehungen zwischen ihnen – und das über einen Bogen von bald 20 Jahren. Das ist im Ansatz kühn und braucht einen langen Atem, und den hat Grillmayer.
Dabei sind es die Details, die viel über die Personen aussagen: wie zum Beispiel die Stimme von Jolas Mutter, die im Vergleich zum ersten Buch deutlich seltener als Leitstern auftaucht – ein Zeichen dafür, dass Jola sich die Selbstsicherheit, die sie an ihrer Mutter bewundert hat, nun selbst erarbeitet hat; wie die neue Selbstverständlichkeit, mit der die früheren „Konkurrenten“ Marek und Jakob nun miteinander umgehen; wie die Art und Weise, in der die nächste Generation sich ohne Zögern umeinander sorgt und kümmert, mit welcher Klarheit die jungen Menschen durch die Welt navigieren, die für sie nicht durch Verlust, sondern vielmehr durch Entdecken gekennzeichnet ist. Es ist eine der berührendsten Stellen, als Jola versteht, dass ihre Kinder langsam erwachsen werden: „Alle ihre Kinder waren so, sie wirkten auf sie viel älter und reifer, als sie selbst es in dem Alter gewesen war. […] Ebenso wie das Leben selbst waren auch ihre Kinder härter, als sie es gewesen war. Es machte sie traurig, aber sie respektierte es auch.“ (S. 264)
„Geschichte, antwortete Jola und stand von der Bank auf, ist das Wichtigste überhaupt“ (S. 198), heißt es an einer Stelle in Ein sicherer Ort. Für Jola & Co. erweist sich Johanna Grillmayer als aufmerksame, stilsichere und behutsame Geschichtsschreiberin. Sie kommt ihren Figuren so nahe wie möglich, schafft es aber, einen Abstand zu wahren, der sie atmen lässt und zu nachvollziehbaren, fast realen Menschen macht, denen man manchmal gern den Arm um die Schulter legen möchte, um sie zu trösten, wenigstens einen Moment lang. Sie alle geraten immer wieder an Grenzen, sie gehen in die Irre, versteigen sich in unrealistische Ideen, halten länger an Dingen und Menschen fest, als gut für sie ist. „Unser Leben lang werden wir vielleicht nicht verstehen, was es bedeutet, was es war und warum es passiert ist. Und warum es uns noch gibt – gerade uns – und euch.“ (S. 276 f.), sinniert Em bei einer Versammlung über das „Ereignis“, und findet damit Worte, die eine allgemeine Gültigkeit besitzen, denn es gilt schließlich, aus der Zeit, die uns gegeben ist, das Beste zu machen, für uns und unsere Mitmenschen.
In Johanna Grillmayers spekulativer Fiktion haben sich die Umstände geändert, aber nicht das Wesen der Menschen. Das heißt nicht, dass es nur Momente der Verzweiflung, sondern auch ein riesiges Reservoir an Optimismus, Verständnis und Willen für eine bessere Zukunft für alle gibt. Da glaubt Em an eine erste Zugverbindung in eine andere Stadt; da nehmen die Kinder ihr Schicksal selbst in die Hand; da findet sich ein Weg, Recht zu sprechen. Die Zukunft, sie liegt in den Händen von Menschen, und sie sind der sichere Ort, den sie suchen, wie Jakob Jola klar macht: „Marek. Boris. Alex. Gabriel. Ali. Lennart. Wie Haken in eine Wand schlug er die Namen in den Wind ein, der zwischen Wald und Haus aufkam und seine Worte schwer verständlich machte. Em. Erich. Ania. Er nannte die Namen aller, die ihnen etwas bedeuteten, und zum Schluss die der Kinder; er hörte sich an wie ein Schamane, der seine guten Geister heraufbeschwor. Einziger Schutz gegen die Dämonen. Und Jola, flüsterte er.“ (S. 411 f.)
Stefanie Jaksch war einige Jahre als PR-Verantwortliche und Dramaturgin an deutschen Theatern tätig, seit 2011 lebt und liest sie in Wien, wo sie bis 2023 die Verlags- und Programmleitung für Kremayr & Scheriau innehatte. Die von ihr konzipierte Essay-Reihe übermorgen wurde u. a. mit dem Bruno-Kreisky-Preis für das Politische Buch ausgezeichnet. Seit 2024 ist die Wortarbeiterin als freischaffende Moderatorin, Kuratorin und Lektorin unterwegs und hat das Büro für Kultur- und Literaturarbeit „In Worten“ gegründet. Im Herbst 2024 erschien bei Haymon ihr Essay Über das Helle – sich selbst versteht sie als (ver-)zweifelnde Anfängerin in immerwährender Transformation.