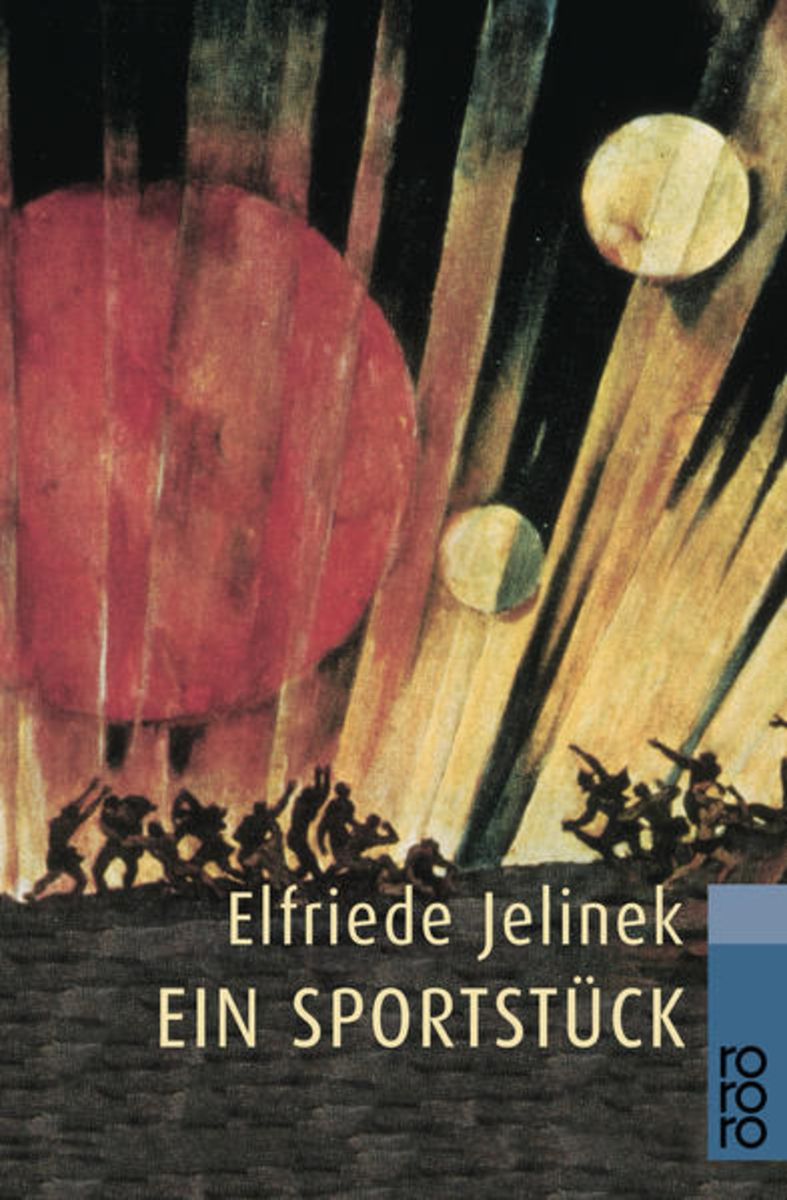Der Aufhänger von Ein Sportstück – das Phänomen Sport und seine weitläufigen gesellschaftlichen Verknüpfungen – ist, so Elfriede Jelinek in einem Interview in „Transparent“ (ORF, Ö1), „eines meiner alten Haßthemen“. In kaum einem ihrer Werke fehlen Seitenhiebe auf den Sport. Hier geht es vor allem um den Sport als eine andere Form von Krieg, Sport als Massenphänomen, und als das „einzig sanktionierte Auftreten von Gewalt“, Sport als „Metapher für Dinge, unter denen sich Gewalt hereinschleicht“. Anders formuliert: um die Masse, ganz im Sinn von Elias Canetti betrachtet, und ihr Verhältnis zur Macht.
Neben diesem Leitmotiv der Gewalt, das Jelinek durch gegnerische Chorgruppen auch optisch sichtbar machen möchte, greift der Text außerdem zahlreiche andere Themen auf. Mehr noch als in „Stecken, Stab und Stangl“ lassen sich klar abgrenzbare Textblöcke herausschälen: Eine Blauensteiner-Szene („Ich töte, das ist die Dienstleistung, die ich produziere“, S. 76), der Auftritt zweier Funktionäre, genannt Achill und Hector, der Monolog des an Überkonsum von Anabolika verstorbenen Bodybilders Andreas Münzer, der seinem großen Vorbild „Arnie“ (Arnold Schwarzenegger) nacheifern wollte.
Der Klagegesang einer Mutter um ihren im Sport umgekommenen Sohn wird zu einem Thema, das in unterschiedlicher Konstellation den ganzen Text durchzieht: Es geht um das Verhältnis der Mutter zum Sohn, der Tochter zum Vater, beides geprägt durch den Tod. Zugespitzt und überhöht wird dieses tragische Eltern-Kinder-Motiv durch die Monologe von „Elfi Elektra“.
In dieser Figur prallt zudem die Dimension der antiken Tragödie mit den Niederungen der gegenwärtigen Kulturpolitik zusammen. Die Autorin spielt in den bitterbösen Selbstporträts der „Elfi Elektra“ und der „Autorin“ nicht nur auf die Plakatkampagne der FPÖ an – „Lieben Sie Scholten, Jelinek, Häupl, Peymann … oder Kunst und Kultur“ -, sondern zieht gewissermaßen das, was sonst außerhalb des Textes passiert, konsequent in den Text hinein: die Beschimpfungen, denen Elfriede Jelinek selbst ausgesetzt war und ist. Da heißt es etwa, „Frau Autorin […], Sie denken nicht gesund und sind wohl auch nicht ganz gesund.“ (S. 49).
Das Auf-die-Spitze-Treiben des Subjektiven ist wahrscheinlich das Auffälligste an diesem Stück. Elfriede Jelinek spricht im Interview von einem „radikalen Subjektivismus“, der sogar ihren autobiografischen Roman „Die Klavierspielerin“ übertrifft, und den sie auch als eine Art Resignation begreift: „Ich habe gedacht, daß das Theater ein Ort der politischen Auseinandersetzung ist. Dieses Stück ist im Grunde Mein-mir-selbst-Eingestehen des Scheiterns dieser Bemühungen. […] Es ist natürlich auch gleichzeitig die Wehmut über dieses Scheitern und auch die Verzweiflung, eigentlich Jahrzehnte etwas gewollt zu haben, was heute lächerlich ist. […] Ich würde sagen, das Stück ist ‚die Tragödie einer lächerlichen Frau‘.“