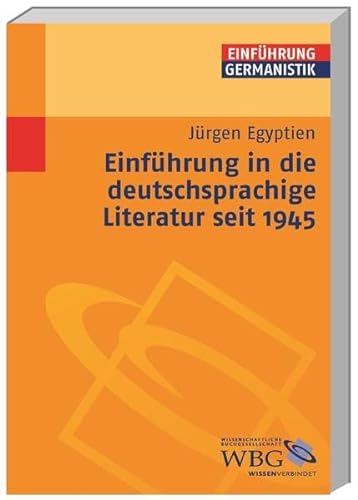Eine Stärke des Buchs liegt in der durchgehenden Didaktisierung, ohne dass Egyptien Zugeständnisse an das Niveau machte, insbesondere vermeidet er es, irgendwelche pseudodidaktischen, infantilen Vermittlungsstrategien einzusetzen. Er versteht es vielmehr, Probleme und Sachverhalte in der gebotenen Kürze sowohl klar verständlich als auch anspruchsvoll (etwa bei der Definition und Verwendung literarhistorischer Begriffe) auf den Punkt zu bringen. So macht er im ersten der fünf großen Kapitel seiner Darstellung durchaus überzeugende Vorschläge zur Periodisierung der Literatur seit 1945, zugleich jedoch gelingt es ihm auch, das Bewusstsein für die grundsätzliche Problematik von Epochenbegriffen und Periodisierungen allgemein, der Literatur seit 1945 im speziellen zu wecken beziehungsweise zu sensibilisieren, indem er die Annahme von scharfen „Zäsuren“ in Frage stellt und stattdessen den das Gleitende betonenden Begriff „Schwellen“ (um 1959/61, 1972/73, 1989) bevorzugt oder indem er – durchaus nicht originell, gleichwohl pragmatisch – sechs Phasen der Literatur von 1945 bis 2000 vorschlägt, die sich im wesentlichen mit den einzelnen Jahrzehnten decken.
Diese Einteilungsangebote haben ihre Plausibilität, andere ließen sich unschwer finden (etwa – mit Heinrich Böll und Walter Jens als Kronzeugen – ein Einschnitt um 1952 als dem Ende der durch „antikalligraphische“ Haltung gekennzeichneten „Kahlschlag“-, „Trümmer“- und „Heimkehrerliteratur“). Egyptien lässt auch keinen Zweifel, dass seine Vorschläge nur Hilfskonstrukte sind und dass nicht darüber hinweggesehen werden darf, dass die Entwicklung der Literatur in den einzelnen Gattungen (speziell in der Lyrik) zum Teil abweichend vom mainstream verläuft und dass es auch Kontinuitäten gibt in personeller („Veteranen der Gruppe 47 und des sozialistischen Aufbaus“) und thematischer Hinsicht (Bezug auf NS-Verbrechen) sowie in ästhetischen Verfahren wie der von ihm sogenannten „Technik der Inversion“ (von Mythen etc.) oder der „Remytholigisierung“, die er – diskussionswürdig – als wichtigste „ästhetische Antworten auf den Katastrophenzusammenhang des 20. Jahrhunderts“ einschätzt.
Eine weitere Stärke der Darstellung von Egyptien, speziell in den Kapiteln III (Historische und kulturelle Kontexte) und IV (Aspekte und Geschichte der Literatur) ist, dass er zwar vier Nationalliteraturen und die deutschsprachige Literatur in fremdsprachigem Umfeld beziehungsweise deutschsprachige Migrations-Literatur in ihrer jeweiligen Eigenheit und ihren jeweiligen Kontexten wahrnimmt, diese ernst nimmt (anders etwa als die großen Literaturgeschichten im Beck- und im Hanser-Verlag, die, wie jene, die nicht integrierbare Literatur in Appendices abschiebt oder, wie diese, von „Austriakischen Variationen“ spricht). Egyptien nimmt jedoch keine scharfen Trennungen vor, zeigt vielmehr Dissimultaneitäten ebenso auf wie Simultaneitäten (z. B. an der von ihm in allen vier „Nationalliteraturen“ beobachteten „Schwelle“ um 1959/61 mit Verweis auf die Blechtrommel von Günter Grass, Uwe Johnsons Mutmaßungen über Jakob, Otto F. Walters Der Stumme und Hans Leberts Die Wolfshaut). Auf diese Weise wird ein umfassendes Bild der ja durchaus nicht einheitlichen deutschsprachigen Literaturlandschaft entworfen, etwa von den sehr unterschiedlichen kulturpolitischen Ausrichtungen unmittelbar nach 1945 in Österreich (mit der Hinwendung zu altösterreichischen Traditionen als Abgrenzung von allem Deutschen), in der Schweiz, in der kein Bruch notwendig erschien und in den verschiedenen deutschen Besatzungszonen, von denen sich insbesondere die sowjetische (SBZ) durch ihre Orientierung am Konzept des Sozialistischen Realismus abhebt.
Die speziellen Bedingungen der diversen Literaturbetriebe werden, jedenfalls für eine Einführung, hinreichend dargestellt, etwa die große Bedeutung des Rundfunks und mit ihm des Hörspiels bis Ende der fünfziger Jahre oder die prekäre Situation für Verlage und Zeitschriften unmittelbar nach 1945. Dabei ist wiederum das Geschick des Verfassers zu beobachten, Sachverhalte auf den Punkt zu bringen: Prägnant erfasst er im Hinblick auf den Kulturbetrieb im Österreich der Nachkriegszeit das Gegeneinander von konservativ beharrendem Konzept in der 1945 gegründeten Kulturzeitschrift „Turm“ (Hofmannsthal-, Weinheber-Verehrung) und an die Moderne anknüpfendem, zukunftsorientiertem Bemühen im „Plan“ (Öffnung für Exilanten, Paul Celan, Hans Lebert, Friederike Mayröcker u. a.) und damit ein Ringen, das die österreichische Literatur bis in die sechziger Jahre prägen sollte.
Ebenfalls knapp und treffend wird auf unterschiedliche (mehr oder weniger explizite) theoretische Konzepte von der christlich-humanistischen Abendland-Ideologie in der frühen Nachkriegszeit bis zu postmodernistischen Haltungen, Spiel mit Intertext und Intermedialität etc. eingegangen, hingegen vergleichsweise umfangreich auf „Ästhetische Modelle, literarische Strömungen, Gattungen und Stile“ vom „Kahlschlag“, der Kurzgeschichte und hermetischer Lyrik über „Frauen-“ oder „Väterliteratur“ bis zur Pop-Literatur und Slam Poetry. Diese Abschnitte zeichnen sich durch präzise Begriffsklärungen (z. B. „hermetisch“, „Sozialistischer Realismus“) und Kurzcharakteristiken (Dokumentarliteratur) aus. Sehr wohl ließen sich verschiedene Modelle etc. finden, die keine Berücksichtigung gefunden haben (etwa das Postdramatische Theater), im Gegenzug werden allerdings sonst eher ausgeblendete Aspekte berücksichtigt, beispielsweise, dass es auch in der SBZ die Hinwendung zu Magischem Realismus oder dass es innerhalb der deutsch-jüdischen Literatur nach dem Ende des Drittens Reichs Verschiebungen durch die Generation nach der Shoah seit den achtziger Jahren gegeben hat.
Notgedrungen muss ein „Abriss der Literatur 1945-2000“ auf knapp 40 Seiten Lücken aufweisen. Daher könnte man reihenweise Namen von Autoren und Werken nennen, die keine Berücksichtigung finden. Es wäre jedoch alles andere als gerecht, bemüht sich Egyptien doch, Schlüssel-Autoren beziehungsweise -Werke der Literatur des genannten Zeitraums nicht nur aufzuzählen, sondern auch zu charakterisieren. Für Österreich ließe sich positiv hervorheben die angemessene Beachtung von Albert Drach oder Hans Lebert (auf dessen Roman Die Wolfshaut von 1960 sich noch 1995 Elfriede Jelinek mit den Kindern der Toten oder Christoph Ransmayr mit Morbus Kitahara berufen). Beide finden in der rund 1200 umfassenden zweiten Auflage der Barner-Literaturgeschichte bei Beck (ebenfalls 2006) nicht einmal Erwähnung. Ebensowenig wird bei Barner innerhalb der Schweizer Literatur ein Peter Lehner berücksichtigt, der „eine eigenständige Spielart der politischen Lyrik der späten 60er und frühen 70er Jahre“ vertritt. Die höchst originellen Texte dieses Autors dürften nicht wenigen Literaturexperten bislang entgangen sein.
Auch die meisten Schwerpunktsetzungen Egyptiens lassen sich gut nachvollziehen, so, dass er dem zwar von Kennern hochgeschätzten, jedoch immer noch zu wenig beachteten Werk eines Wolfgang Koeppen, mit dem „der Beginn avancierter moderner Schreibweisen nach 1945“ angesetzt werden kann, mehr Aufmerksamkeit widmet als dem des späteren Nobelpreisträgers Heinrich Böll, dessen Romane und Kurzgeschichten in ihrer Zeit große Wirkung erzielt haben, heute jedoch eher abgestanden anmuten. Koeppen ist es auch, der mit Tauben im Gras unter den lediglich sieben (jeweils knapp fünf bis neun Seiten umfassenden) Einzelanalysen vertreten und damit hervorgehoben ist. Mit der Auswahl dieser speziellen Interpretationen ist Egyptien zweifellos das größte „Risiko“ eingegangen, diese ließe sich in besonderem Maße „völlig anders“ treffen. „Repräsentativ“ sind die Erwählten allemal: Neben Koeppen erscheinen Friedrich Dürrenmatt mit dem Besuch der alten Dame, Ernst Jandl mit wien: heldenplatz, Paul Celan mit Du liegst, Heiner Müller mit der Hamletmaschine, Christa Wolf mit Kassandra und Hanns-Josef Ortheil mit Schwerenöter. Bei dieser Auswahl hat Egyptien offensichtlich auf Ausgewogenheit wert gelegt im Hinblick auf Entstehungszeit (nur die unmittelbare Nachkriegsphase ist nicht vertreten), Gattungszuordnung (dreimal Roman, je zweimal Drama und Lyrik) und nationale Zugehörigkeit (neben jeweils zweimal BRD und DDR, sowie einmal Österreich und Schweiz ist mit Celan ein Vertreter deutschsprachiger Literatur aus fremdsprachigem Umfeld berücksichtigt).
Hinzuweisen wäre noch auf einen Überblick verschaffenden kurzen Forschungsbericht (Kapitel II), der ergänzt wird durch ein kommentiertes Literaturverzeichnis, sowie ein Personen- und ein Sachregister. Dieses vor allem erleichtert das Nachschlagen nach Grundbegriffen sehr.
Alles in allem geht es wohl – wie schon eingangs gesagt – kaum besser. Notwendigerweise hat diese kurze Darstellung der deutschsprachigen Literatur nach 1945 ihre Informationslücken, aber Egyptien schärft das Bewusstsein für Periodisierungsfragen, Begriffsdefinitionen etc., bringt sogar Wichtiges zur Sprache, das in anderen (umfangreicheren) Literaturgeschichten unbeachtet bleibt, und schafft Übersichtlichkeit, ohne die Unübersichtlichkeit zu verschleiern.