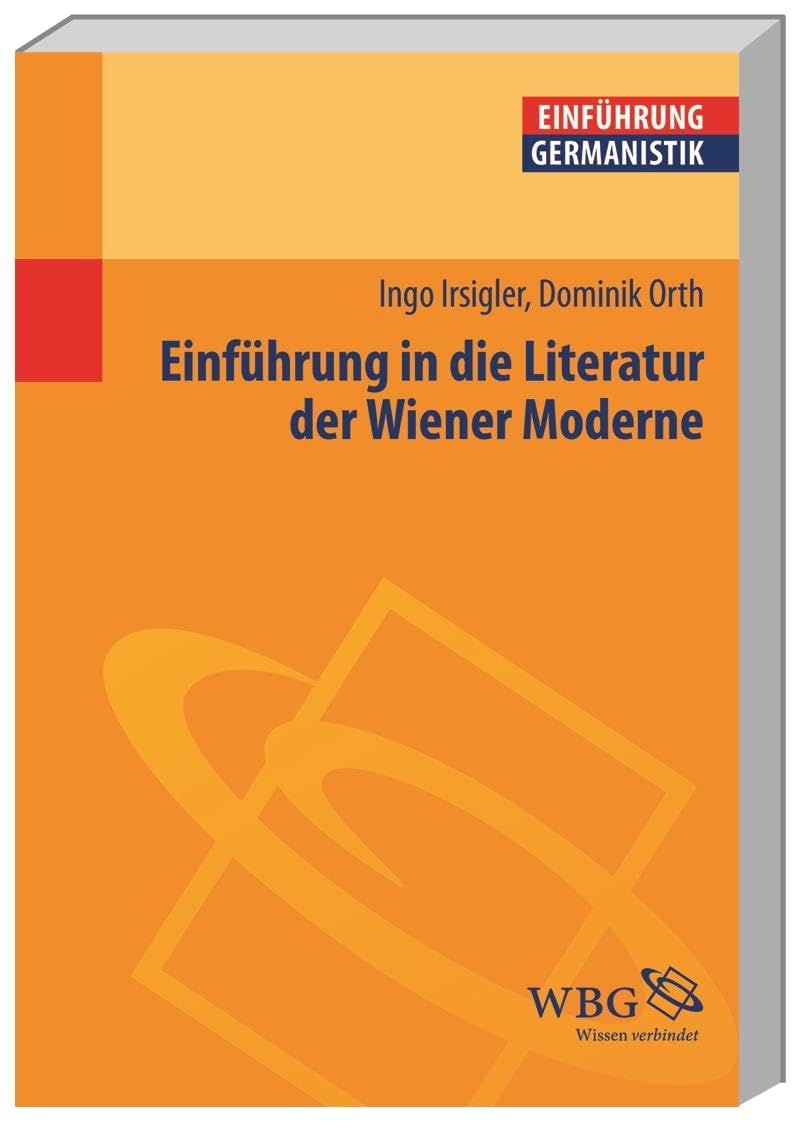In vier allgemeinen Abschnitten und einem Kapitel mit „Einzelanalysen repräsentativer Werke“ unternehmen die beiden Autoren das schwierige Unterfangen, vor dem Hintergrund einer als „produktives kulturelles Milieu“ postulierten Interdisziplinarität um 1900 die heterogene Literatur dieser Epoche als Einheit in einem höheren Sinn darzustellen. Das zentrale Problem dabei schreibt sich seit der Neukonfiguration der Wiener Moderne fort. Konstrukte dieser Art sind meist nur lebensfähig, wenn sie mit massiven Ausblendungen und Reduktionen arbeiten. In diesem Fall hatten und haben diese Blickverengungen zumindest auf zwei Ebenen fatale Folgen: Die untersuchten Milieus sind ausschließlich männlich definiert, und die Konstruktion eines Beginns der „Moderne“ mit dem Auftritt von Jung Wien hat einen radikalen Schnitt zur etwas älteren AutorInnengeneration zur Voraussetzung.
Beide Aspekte prägen auch die vorliegende Einführung. Die „(damals noch vorhandene) Unmöglichkeit, neue Weiblichkeitskonzepte zu etablieren und traditionelle Rollenmuster aufzubrechen“ (S. 70) ist im historischen Rückblick nur dann „vorhanden“, wenn alle im kulturellen Feld agierenden Frauen wie Rosa Mayreder, Else Jerusalem, Alma Mahler, Minna Kautsky, Olga Wisinger-Florian oder auch Eugenie Schwarzwald konsequent ausgeblendet werden. Dann bleibt nur der Ausweg, neue „Liebeskonzepte“ am Beispiel von Hermann Bahrs – an mehreren Stellen und insgesamt ausführlicher als Schnitzlers Reigen gewürdigten – Roman Die gut Schule abzuhandeln und nicht Mayreders Erzählungen oder ihre Untersuchung Zur Kritik der Weiblichkeit von 1905 heranzuziehen.
Tatsächlich finden sich im Personenregister dieser Einführung nur drei Namen von Frauen: mit je einem Eintrag Bertha Pappenheim – nicht mit ihren eigenen Werken, sondern als Analyseobjekt Freuds – und Franziska Reventlow, mit drei Erwähnungen Berta (!) Zuckerkandl in ihrer Funktion als Salonière. Es wäre völlig falsch, den beiden Autoren eine Fortschreibung der Misogynie der Jahrhundertwende zu unterstellen. Die weitgehende Absenz der Frauen zeigt lediglich, dass die Forschung – nicht in Einzeluntersuchungen, aber dort, wo das Ganze in den Blick genommen wird – nach wie vor auf dieselben Quellen zurückgreift. Außerdem bedarf es für die Sichtbarmachung weiblicher Akteure, die ja auch in der autobiografischen Texten ihrer männlichen Kollegen allenfalls am Rande vorkommen, immer einer bewussten Entscheidung und viel zusätzlicher Arbeit.
Noch weniger kann man den beiden Verfassern anlasten, dass sie die Nähe eines Ferdinand von Saar – er schrieb übrigens das Titelgedicht für die Zeitschrift Ver Sacrum, die im Buch ausführlich gewürdigt wird (S. 22) – zu den Autoren und auch zu den Konzepten der jungen Generation nicht wahrnehmen. Freilich ist es aus österreichischer Sicht leicht irritierend, wenn im Abschnitt „Konzepte von Leben und Tod“ als Kontrastfolie zu Schnitzlers Erzählungen Autoren des bürgerlichen Realismus wie Theodor Storm und Conrad Ferdinand Meyer herbeizitiert werden (S. 62f.). Näherliegender wäre eben Saar, der bereits 1892 in einer Novelle einen Fall von Hysterie beschrieb und auf Handlungsebene umgehend Dr. Josef Breuer herbeirufen ließ, dessen gemeinsam mit Freud verfasste Studien zur Hysterie erst 1895 erschienen. Breuer beriet auch Marie von Ebner-Eschenbach, die in ihrem Werk immer wieder psychische ,Auffälligkeiten‘ darstellte. Freilich ist die Absenz dieser beiden Namen aus bundesdeutscher Sicht auch verständlich. Da Saar wie Ebner-Eschenbach adeliger Herkunft waren und sich auch in diesem Milieu bewegten, werden sie in den Literaturgeschichten selten im Kapitel „Bürgerlicher Realismus“ abgehandelt, sondern meist als österreichische Sonderfälle.
Dennoch gelingt den beiden Autoren über weite Strecken auch etwas von der Ambivalenz der Epoche zu vermitteln, der mit dem Begriff „Stilpluralismus (S. 81) wohwollend umrissen werden kann. So wie bei den Autoren, ist es auch bei den Künstlern der Zeit nicht immer unproblematisch, sie für die „Moderne“ zu reklamieren. Klimt war eben nicht nur in seinen Anfängen ein „Dekorationsmaler“ (S. 21), er fertigte noch 1908, als Der Kuss entstand, für den Kaiser-Jubiläumsfestzug Kostümentwürfe an.
Ausführlich dargestellt wird die Rolle Hermann Bahrs als Propagandist von Jung Wien; für die rasche Etablierung der jungen Autorengeneration im Herzen des Literaturbetriebs vielleicht bedeutsamer waren Personen wie Theodor Herzl als Feuilletonchef der Neuen Freien Presse oder Max Burckhard als Burgtheaterdirektor, die beide nicht erwähnt werden. Unumstößlich eingeschrieben hingegen ist dem literarhistorischen Blick Leopold von Andrians Garten der Erkenntnis – den Kraus schon bei Erscheinen nicht ganz zu Unrecht als „Kindergarten der Unkenntnis“ bezeichnete.
Diesem Roman ist auch im vorliegenden Band – gemeinsam mit Hofmannsthals Reitergeschichte eine der Einzelanalysen gewidmet, genauso wie Peter Altenbergs Wie ich es sehe, Richard Beer-Hofmanns Der Tod Georgs wird gemeinsam mit Schnitzlers Sterben untersucht, Frau Beate und ihr Sohn gemeinsam mit Schnitzlers 1924 erschienenen Novelle Fräulein Else und sein erstes Erfolgsstück Liebelei mit Hofmannsthals Jedermann, beides Werke mit „explizite[m] Zeitbezug“, damit einem „gesellschaftskritische[m] Potenzial“ (S. 115). Schon die Kombination dieser Werkgruppen macht die Schwierigkeit beim Schreiben dieser Einführung deutlich, die mit 120 Textseiten auskommen musste.
Aus der Perspektive der Reihe „Einführung Germanistik“ wäre aber vielleicht doch zu überlegen, ob nicht ein Band zur literarhistorischen Revision dieser vielleicht besonders dogmen- und klischeebehafteten Epoche angedacht werden sollte. Was Peter Altenberg betrifft sollte sich freilich auch eine in konventionellen Bahnen bleibende Epochendarstellung im Jahr 2015 nicht damit begnügen, die manifesten Bedenklichkeiten seiner Texte und seines Lebens, was Kinderpornographie und Pädophile betrifft, mit Formulierungen wie „Poetik des Andeutens“, „formale Entgrenzung“ oder „Deutungsambivalenz“ (S. 83) zu kaschieren. Auch dass die Aufführungsgeschichte des Salzburger Jedermann beispielhaft die „bis heute andauernde Bedeutung der Literatur der Wiener Moderne“ zeige, „die nicht zuletzt auch in ihrer gesellschaftlichen Relevanz begründet“ (S. 126) liege, mag man bezweifeln.