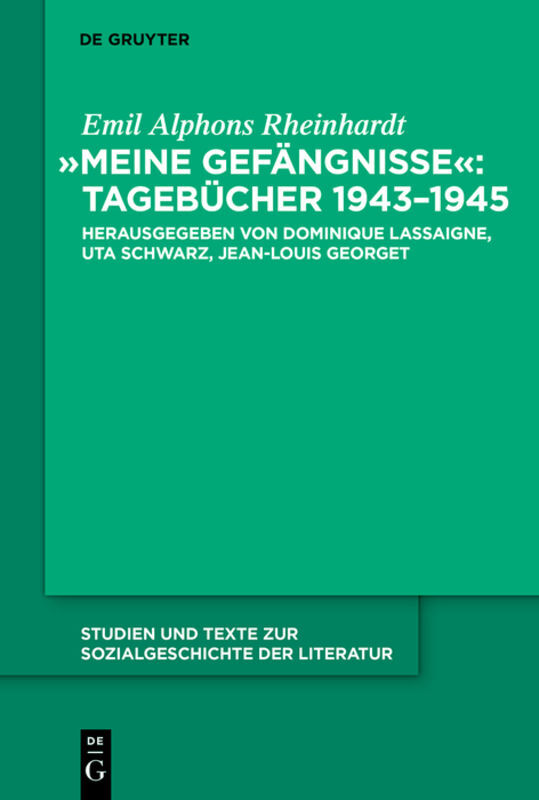Rheinhardt, 1889 in Wien in eine katholische, eher konservative Familie hineingeboren, von apolitischem Selbstverständnis, brach ein Medizinstudium, u. a. bei Freud ab, begann als Lyriker, der in den Wiener literarischen Zirkeln der Zeit durchaus wahrgenommen wurde, in Kontakt stand zu Hofmannsthal, Csokor, Rilke. Diesem folgte er 1916 nach einem kurzzeitigen Einsatz als Sanitäter in der Propagandaabteilung des k. u. k. Kriegsarchivs nach, wo er mit Csokor zusammenarbeitete. Größeren Erfolg als mit seinen symbolistischen Gedichten erzielte er als Balzac-Übersetzer – Glanz und Elend der Kurtisanen wurde noch 2007 und 2009 in seiner Übersetzung bei Diogenes erneut veröffentlicht – sowie zwischen den späten 1920er- und der Mitte der 1930er-Jahre mit mehreren im Trend der Zeit liegenden Romanbiografien, insbesondere mit seiner Lebensgeschichte der Eleonora Duse. Diese biografischen Romane wurden übrigens allesamt auch noch in der NS-Zeit verlegt, Indiz dafür, dass Rheinhardt nicht als Widerstandskämpfer, sein Werk mithin auch nicht als – wie es im Nazi-Jargon hieß – „unerwünschtes Schrifttum“ galt.
Er hatte sich nach längeren Aufenthalten in Italien und Frankreich in den Zwanzigerjahren schon 1930 in Le Lavandou an der französischen Mittelmeerküste niedergelassen, war also nicht erst vor Hitler geflohen. In Le Lavandou stand allerdings sein Haus offen auch für Emigranten aus Nazi-Deutschland und dem faschistischen Österreich, vor allem für Autoren, unter ihnen für Csokor, Thomas, Klaus und Golo Mann, für Feuchtwanger, Hasenclever, Kisch, Weigel, Werfel, Kantorowicz oder Schickele. Mit dem „Anschluss“ Österreichs an Deutschland, den er unter Freunden als „Diebstahl“ (S. 5) bezeichnete, bezog er insofern erstmals dezidiert politisch Position, als er gemeinsam mit Musil, Werfel, Joseph Roth und Polgar die 1938 in Paris gegründete Liga für das geistige Österreich mitinitiierte, die bereits im Mai 1939 anlässlich von Roths Begräbnis letztmalig in Erscheinung treten sollte.
Mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurde Rheinhardt, der trotz seines langjährigen Aufenthalts im Gastland vergeblich um dessen Staatsbürgerschaft ansuchte, vorübergehend als „feindlicher Ausländer“ (S. 6) inhaftiert. Im Vichy-Frankreich glaubte er sich, da keineswegs als Gegner des Regimes exponiert, sicher, ließ ein Thomas Mann zu verdankendes Visum für die USA in Verkennung seiner Situation verfallen, wurde 1943 von den italienischen Faschisten wohl wegen seiner (eher losen) Kontakte zur Résistance verhaftet, bei Verhören physisch gefoltert, aber nie einem Richter vorgeführt, auch nicht, nachdem die Nationalsozialisten nach dem Sturz Mussolinis die Gefängnisse übernommen hatten.
Schwerer zu ertragen als die physische Folterung war für Rheinhardt die psychische durch das angesprochene In-Unsicherheit-Gelassenwerden. Die Klage, eben nicht zu wissen, wessen er sich schuldig gemacht haben sollte, und die Hoffnung, nach monatelanger Inhaftierung unter unmenschlichen ernährungsmäßigen und hygienischen Bedingungen endlich einem Richter vorgeführt zu werden, durchzieht den ersten Teil seiner Tagebuchaufzeichnungen zwischen Ende November 1943 und Mitte April 1944.
In seiner Besprechung von deren erstmaliger Publikation 2003 hat Erich Hackl die Situation des Häftlings treffend als kafkaesk bezeichnet (vgl. Die Presse, Spectrum v. 10.5.2003). In Zusammenhang mit dem Warten als Folter steht eine Verschiebung der Wahrnehmung von Zeit. Reflexionen über das Zeitgefühl, das Bewusstsein des Verlusts an Lebenszeit bestimmen sehr eindrücklich die Aufzeichnungen. Was diese besonders auszeichnet, ist das Festhalten unmittelbarer, nicht durch Erinnerung verstellter Erfahrungen, des Leidens an diversen Schikanen, vor allem an Entzug von Essen, an Hofgängen, der Angst vor zwangsläufig sich einstellenden Erkrankungen, des rapiden Fremdwerdens des eigenen Körpers, des Mangels an intellektuellem Austausch, dem Ärger auch über manche unangenehme Eigenschaften der Mitgefangenen, der Ungewissheit aufgrund fehlender Nachrichten von außen (vor allem über den Fortgang des Kriegs). In dieser Situation bietet die Möglichkeit, Erlebtes unmittelbar niederzuschreiben, eine Überlebenshilfe, ja das Schreibenkönnen wird geradezu als Entschädigung gesehen, als Chance auch, die deutsche Sprache nicht zu verlieren. Dementsprechend empfindet Rheinhardt – wie später Günter Eich in seinem berühmten Inventur-Gedicht – seine Schreibgeräte, zuerst einen Bleistiftstummel, dann eine Füllfeder, als wahre Schätze. Neben den Reflexionen über das Schreiben, über die Notwendigkeit auch, sich wegen der Gefahr des Entdecktwerdens einer verdeckten Schreibweise zu bedienen, stechen besonders auch die über Fragen des Wertes von religiöser Haltung sowie über den Verlust an liebevollen zwischenmenschlichen Beziehungen und der Freude an schönen Dingen, an Musik und Kunst hervor.
Das Tagebuch aus Frankreich ist von wem auch immer dem Roten Kreuz übergeben worden und von diesem weiter an Rheinhardts Sekretärin und zeitweilige Lebensgefährtin Erica de Behr, die es ihrerseits der Wiener Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands überließ. Sie hat für die Erstveröffentlichung von 2003 die schon angesprochenen Eingriffe in den Text vorgenommen, insbesondere Personen sowie die religiöse Einstellung des Autors und seine Beschäftigung mit der Bibel und anderer religiöser Literatur betreffend. De Behr glaubte, das Bild von Rheinhardt als einem areligiösen Menschen bewahren zu müssen. Diese Verfälschungen wurden in der nun vorliegenden Edition korrigiert. Gerade die Reflexionen über Religiosität spielen in der Haftzeit Rheinhardts eine große Rolle. Auf dem Transport nach Dachau, den er als schlimmsten Horror, als „mörderisch“ (S. 204) erfahren hat, soll er bei einem französischen Bischof, einem Mitdeportierten, den Wiedereintritt in die katholische Kirche vollzogen haben.
Das Dachauer Tagebuch, die Zeit von Ende Oktober 1944 bis Mitte April 1945 erfassend, wurde erst 2005 in England entdeckt, sollte einem Wunsch von Rheinhardts englischer Lebensgefährtin Theodora Meeres zufolge verbrannt werden, blieb jedoch dank Marie Thérèse Fisher, einer anderen englischen Freundin, erhalten. Und dies wohl im Sinn des Autors, wenn man an seinen Appell „nicht [zu] vergessen“ denkt. Die Zustände im Konzentrationslager Dachau übertrafen die Schrecken der französischen Gefängnisse bei Weitem, und das „Wartesaalgefühl“ (S. 186) bedrückte Rheinhardt nach wie vor, gleichwohl zeigt er sich gottergeben und ist dankbar dafür, dass es ihm trotz diverser Erkrankungen vergleichsweise gut geht.
Dank seiner medizinischen Vorbildung wird er vorerst als Schreiber im Krankenrevier eingesetzt, hat Zugang zu etwas besserer Verpflegung und vor allem auch zu Lektüre, zur Bibel, zu Gotthelf, Keller, Stifter oder auch zum Literaturgeschichtswerk Die deutsche Romantik von Richard Benz, durch die sich ihm eine Gegenwelt zur KZ-Realität eröffnet. In dem niederländischen Journalisten und Schriftsteller Nico Rost, der in seinem Erinnerungswerk Goethe in Dachau Rheinhardt erwähnt, fand er einen Partner für anregenden intellektuellen Austausch. Als Typhus auch unter Ärzten zu grassieren beginnt, wird er als Arzthelfer eingeteilt, was ihm schließlich zum Verhängnis werden sollte.
Die vorliegende Edition zeichnet sich durch Sorgfältigkeit der Textwiedergabe aus, bietet auch hilfreiche Anmerkungen und Übersetzungen. Es sind eher kleine Fehler und Ungereimtheiten, die zu beanstanden wären. Dass der Vorname Freuds in der Einleitung falsch, im Register korrekt und der Name Hofmannsthal zweimal richtig, zweimal falsch (S. 145, Anm. 83; S. 144) geschrieben erscheint, ist eine unnötige Schlamperei; dass die niederösterreichische Stadt Ternitz nicht südöstlich, sondern südwestlich von Wien liegt (S. 185, Anm. 4), hätte ein kurzer Blick in einen Atlas erkennen lassen, „poor me“ ist mit „mich Ärmsten“ (S. 126) nicht ganz genau übersetzt. Unverständlich allerdings, dass in der Zeitleiste zur Überlieferung der Tagebücher von Emil Alphons Rheinhardt die „letzte Tagebucheintragung“ mit 12.2.1945 datiert wird, während sie nachweislich des Abdrucks am 14.II[.1945] getätigt wurde. Das sind Petitessen angesichts des Verdienstes dieser Edition: Zwar sind es keine großen Neuigkeiten, die man aus den Tagebüchern Rheinhardts erfährt, unmittelbar, wie erwähnt, wird man jedoch bei der Lektüre mit den Erfahrungen von Unmenschlichkeit konfrontiert und eingestimmt auf ein „nicht vergessen“.