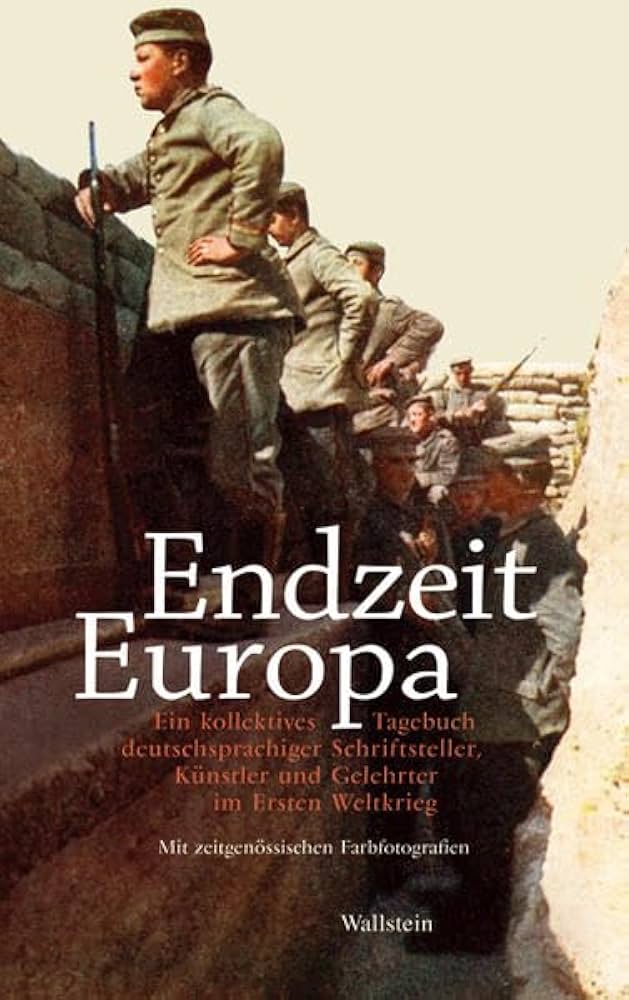Der 2008 als Begleitbuch zu einer gleichnamigen Ausstellung erschienene Band Endzeit Europa ist zwar wesentlich bescheidener dimensioniert als das zehnbändige „Echolot“, wendet aber dasselbe Gestaltungsprinzip auf den Ersten Weltkrieg an. Das zeigt sich zum einen daran, dass dem Buch ein kurzes Geleitwort beigegeben ist, das Kempowski im Frühjahr 2007, ein halbes Jahr vor seinem Tod, verfasst hat; zum anderen aber wird hier ausdrücklich der Begriff „kollektives Tagebuch“ aufgegriffen, den Kempowski zur Bezeichnung seines Projekts geprägt hat.
Natürlich wussten die 117 Frauen und Männer, die in diesem Band in streng chronologischer Folge zu Wort kommen, zu ihren Lebzeiten nicht, dass sie an einem „kollektiven Tagebuch“ arbeiteten. Sie schrieben einfach auf, was sie bewegte, und erst der auswählende und ordnende Blick des Herausgebers Peter Walther verknüpft ihre Äußerungen nachträglich zu einem vielstimmigen Ganzen. Während in Kempowskis „Echolot“ Menschen aus allen möglichen Berufs- und Lebensbereichen zitiert werden, beschränkt sich „Endzeit Europa“ allerdings auf Stellungnahmen von „Schriftstellern, Künstlern und Gelehrten“. Und im Unterschied zu Kempowski, der auch Zeitungsartikel, Flugblätter und dergleichen in seine Collage integrierte, hat Peter Walther nur die Textsorten „Tagebuch“ und „Brief“ in seine Anthologie aufgenommen. Wie er in seinem Nachwort erläutert, erhofft er sich von dieser Beschränkung auf seinerzeit unpublizierte Texte Aufschlüsse über die Befindlichkeit der bürgerlichen Intellektuellen in den Jahren 1914 bis 1918: „In den Briefen und Tagebüchern spricht sich das Erlebte unmittelbar aus, während die publizierten Äußerungen stets mit einer mehr oder weniger politischen Wirkungsabsicht verbunden waren.“ (S. 366)
Mit den „publizierten Äußerungen“, die Walther hier erwähnt, ist jene Kriegspropaganda gemeint, die den Ersten Weltkrieg von Anfang an begleitete: Wissenschaftler, Schriftsteller und Künstler wurden (mehr oder weniger explizit) dazu verpflichtet, mit kämpferischen Leitartikeln und militaristischen Gedichten zur geistigen „Wehrhaftmachung“ beizutragen. Insbesondere im Jahr 1914 überschwemmte eine Flut chauvinistischer Schriften die Zeitungen, Zeitschriften und Bücher, und manch ein Autor hat sich wenige Jahre später für diese literarischen Aufrüstungsbemühungen geschämt.
Vor diesem Hintergrund ist es aufschlussreich zu lesen, was Intellektuelle in dieser aufgeputschten Zeit ihren Tagebüchern anvertrauten und was sie in privaten Briefen einzelnen Adressaten mitteilten. Es entspricht dem Konzept des „kollektiven Tagebuchs“, dass dabei vieles zu erfahren ist, was nicht in das Bild passt, das sich die Nachgeborenen vom Ersten Weltkrieg und vor allem von dessen verschiedenartigen Akteuren gemacht haben. So ist es zum Beispiel überraschend, dass Rainer Maria Rilke im Oktober 1914 einen Aufruf zu patriotischer Gedichtproduktion in einem Ton verweigerte, dessen Schnoddrigkeit in scharfem Kontrast zum geläufigen Bild vom ästhetisch-feinsinnigen Poeten steht: „‚Kriegslieder‘ sind keine bei mir zu holen, beim besten Willen.“ (S. 100) Erstaunlich auch, dass der prinzipiell pazifistisch gestimmte Stefan Zweig 1914 in sein Tagebuch schrieb: „Die deutschen Siege sind herrlich …“ (S. 58). Als Zweig dann ein Jahr später die deutsch-österreichische Niederlage kommen sah, bemühte er zur Beschreibung dieser Tatsache im privaten Tagebuch denselben Mythos, den die deutschen Schlachtenlenker auch in ihren offiziellen Verlautbarungen im Gebrauch hatten: „Das Nibelungenlied erfüllt sich, das Lied von der Nibelungen Not.“ (S. 157). Und Stefan Zweigs Namensvetter Arnold Zweig, der in späteren Jahren antimilitaristische Romane wie „Erziehung vor Verdun“ oder „Der Streit um den Sergeanten Grischa“ schrieb, erklärte im August 1914 in einem Brief: “ … der fette Bürger, unser Antagonist, lernt plötzlich wieder sich einordnen, opfern, echt fühlen – er verliert seine moralische Häßlichkeit, er wird schön!“ (S. 60)
Während Arnold Zweig also (wie viele expressionistisch bewegte Künstler) den Krieg als anti-bürgerliche Veredelungskur feierte, konstatierte die greise Marie von Ebner-Eschenbach im selben August 1914 in illusionsloser Altersprosa: „… daß dieser Krieg kommen müsse, war ich längst überzeugt – (man häuft nicht durch Jahrzehnte Gebirge von Zunder auf und schleicht mit feiger Hinterlist um sie herum und versichert: ‚Ich zünd‘ sie nicht an!‘).“ (S. 52)
Und eine andere Schriftstellerin, Ricarda Huch, schildert die patriotische Aufwallung der Deutschen (zumindest in einem privaten Brief) ironisch distanziert: „Ich persönlich stehe allem fern, und ich bin ja nun einmal für das Komische empfänglich, ich kann nichts dafür – ich muss über manches lachen – , zum Beispiel, daß jetzt schon jeder ein Schurke ist, außer den Deutschen und der zu ihnen hält, und daß alle Gott anrufen und überzeugt sind, er würde die verfluchten Feinde vertilgen usw.“ (S. 43) Es finden sich noch mehr Zitate, die beweisen, dass die Frauen den Krieg kritischer sahen als die meisten Männer. Dennoch erklärt dieselbe Ricarda Huch in dem gerade zitierten Brief auch: „Wenn ich ein Mann wäre, ging ich gerne mit, aktiv sein ist immer schön.“
Und die Zeichnerin und Malerin Käthe Kollwitz, die sich dem Gedächtnis der Nachwelt vor allem durch ihre sozialkritische und pazifistische Graphik eingeprägt hat, verschweigt in ihren Tagebüchern nicht, wie stolz sie auf ihren Soldatensohn Peter ist, der zum deutschen Sieg bei Antwerpen beigetragen hat (vgl. S. 88). Und als dieser Sohn wenig später fällt (wie die bekannte euphemistische Vokabel heißt), schreibt die engagierte Sozialdemokratin Kollwitz nicht etwa „mein armer, toter Junge“ in ihr Tagebuch, sondern sie formuliert wie eine patriotische Heldenmuter: „Peter – Du deutscher, deutscher Junge …“ (S. 126).
Ambivalent sind aber nicht nur die Äußerungen der Frauen, die den Krieg im Hinterland erleben, sondern auch die Berichte der Männer, die an der Front kämpfen. Gewiss sind die zitierten Soldatentagebücher und -briefe fast alle in jener harten, gefühlsarmen Sprache verfasst, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als „männlich“ oder zumindest als „soldatisch“ galt. Ein Beispiel unter vielen findet sich im Tagebuch des Lyrikers und Literaturwissenschaftlers Ernst Stadler, der 1914 notierte: „Die Häuser werden in Brand geschossen, der Waldrand wird unter Feuer genommen. Wo sich einer zeigt, kriegt er ein Schrapnell nachgeschickt. Der Major trinkt Rotwein dabei, die Zugführer rauchen.“ (S. 65). Herausgeber Peter Walther zitiert diese Passage in seinem Nachwort (S. 372), um zu demonstrieren, dass gerade die jüngeren Soldaten vor der Gefahr der „Verrohung“ nicht gefeit waren. An diesem Vorwurf mag viel Wahres sein, doch sollte man immerhin auch bedenken, was der Lyriker und Reserveoffizier August Stramm in einem Brief an seine Freunde Nell und Herwarth Walden in die einfachen Worte fasste: „In mir weints und außen bin ich hart und roh“ (S. 40). Sobald man dieses innerliche Weinen mithört, erscheint die äußerliche Rohheit dieser Texte weniger anstößig. Weder Stadler noch Stramm haben übrigens den Krieg überlebt.
Darüber hinaus lässt sich zugunsten dieser Texte noch sagen, dass die kalten und mitleidlosen Beschreibungen die Kriegsrealität präzise abbilden, während die Verlautbarungen der zivilen Geistesgrößen zunehmend hilf- und verständnislos anmuten. Angesichts der Materialschlachten, der Schützengräben und des Stellungskrieges bleiben die kultur- und geistesgeschichtlichen Auslassungen der Großschriftsteller – ob sie nun Gerhart Hauptmann, Thomas Mann oder Rudolf Borchardt heißen – matt, phrasenhaft und altertümlich. Dasselbe gilt erst recht für die farbigen deutschen und französischen Fotos aus dem lustigen Soldatenleben, die dem Buch als Illustrationsmaterial beigegeben sind. Diese Propagandabilder erweisen sich auf den ersten Blick als gestellt und schöngefärbt. Angesichts solch bildgewordener Ideologieproduktion lernt man die schockierende Sachlichkeit des Lyrikers und Stabsarztes Wilhelm Klemm als unsentimentale Schilderung der Wirklichkeit schätzen: „Auf der Station lauter Elend, ein Familienvater starb in 2 Stunden an Gasphlegmonen, er hatte einen ganz simplen Oberschenkelschuß. H. hatte noch, um allem vorzubeugen, den Schußkanal erweitert und dräniert, auf einmal schwillt das ganze Bein ballonartig an, 2 Stunden später Exitus. H. nahm nach der Erzählung eine Embolie an. Aber bei der Sektion kam aus den Muskeln des Beins das Gas geradezu geschäumt.“ (S. 116)
Vieles ließe sich noch zitieren. Je gründlicher man sich aber in das reichhaltige Buch vertieft, desto vielfältiger und desto verwirrender wird das Bild. Am Ende bleibt der Leser mit einem Eindruck zurück, der am prägnantesten in einem Satz von Ernst Jünger ausgedrückt wird: „Im Grunde erlebt jeder seinen eigenen Krieg“ (zitiert auf S. 393).
Diese subjektiv gebrochene Perspektivenvielfalt ist indes keine Schwäche der Anthologie, sondern entspricht genau dem Erkenntnisinteresse des „kollektiven Tagebuchs“. Dem Leser soll hier durch die Vielfalt einander widersprechender Äußerungen klar gemacht werden, dass die Geschichte in Wahrheit aus einer unendlichen Fülle kleiner Geschichten besteht, die sich zu einem einheitlichen Ganzen nicht zusammenfügen lassen.
Allerdings hätte der Herausgeber den Weg durch dieses vielstimmige Labyrinth mit einigen editorischen Handreichungen wesentlich erleichtern können. Zu den Verfassern und Verfasserinnen der Texte gibt es zwar biographische Informationen im Anhang, die aber sehr knapp und kursorisch ausgefallen sind. Über die Empfängerinnen und Empfänger der Briefe erfährt man gar nichts, obwohl es in den meisten Fällen zum Verständnis der Texte nützlich gewesen wäre, zu wissen, wem sie einmal zugedacht waren. Außerdem fehlt ein Namensregister. Und schließlich wird der große historische Kontext, in dem die Texte entstanden sind, zu wenig erläutert. Walthers Nachwort enthält zwar einen kompetenten kurzen Abriss der Geschichte des Ersten Weltkriegs, doch tauchen in den zitierten Texten zu viele unerklärte Fakten und Zusammenhänge aus dem Kriegsgeschehen auf. Angesichts dieser Mängel kann „Endzeit Europa“ wohl vor allem kenntnisreichen Lesern zur Lektüre empfohlen werden.