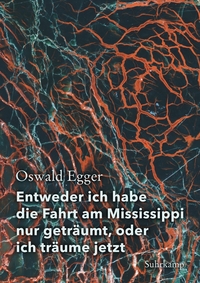Überwältigend ist das Buch, weil es buchkünstlerisch von anmutiger Schönheit ist. Nicht nur ist es durchgehend vierfarbig bedruckt, was bereits ungewöhnlich genug für einen Band mit, ja was?, Lyrik? Prosapoemen? Notaten? ist, es ist geradezu opulent ausgestattet mit Farbillustrationen aus der Hand Eggers plus Zeichnungen aus drei Bänden, die im 19. Jahrhundert erschienen sind, dazu gibt es auch noch, oh Wunder in einem Publikumsverlag, eine mehrteilige Ausklapptafel, die Fachbezeichnung „Altarfalz“ ist dem Kolophon zu entnehmen. Egger hat den Band außerdem selbst gesetzt, also die Textgestalt „designt“, Schrift und Satzspiegel bestimmt, er hat zudem den Schutzumschlag gestaltet und, als wäre all dies nicht genug, gleich noch das fotografische Motiv hierfür aufgenommen. Hätte er es noch eigenhändig gedruckt und gebunden, zumindest einige limitierte römisch nummerierte Spezial-Exemplare, dann wäre es ein Total-Eggerianisches Opus geworden.
Überwältigend ist es aber auch im literarischen Anspruch, in seiner Wortgewalt, in seiner dahinrauschenden Kraft. Der Südtiroler ist ja im Gegensatz zu anderen Ex-Zentrikern der Literatur des 20. Jahrhunderts – man denke an die „Neologen“, an Arno Schmidt (vor allem in seinen späten Werken), an Albert Vigoleis Thelen („Die Insel des zweiten Gesichts“) oder an den Vorarlberger Max Riccabona – in der nicht ganz unglücklichen Lage, seine extrem ambitionierte Kunst abgesichert betreiben zu können. Seit 2011 bekleidet er nämlich an der Kunsthochschule in Kiel eine Professur für „Sprache und Gestalt“. Und er genießt seit einigen Jahren zudem das Privileg, auf der vormaligen NATO-Raketenstation Hombroich (ausgesprochen: Hombrooch) in Neuss bei Düsseldorf, die in den vergangenen 40 Jahren von einem privaten Mäzen als Museums- und Kunst-Areal adaptiert worden ist, ein Atelier auf Lebenszeit kostenlos nutzen zu dürfen.
Ist, was Egger so umfangreich über Natur zu Papier bringt, nun Nature Writing, wie die neudeutsche Bezeichnung für das sich langsam auch hierzulande durchsetzende Genre lautet, ist es noch Nature Writing? Der deutsche Philosoph Jürgen Goldstein meinte in „Naturerscheinungen. Die Sprachlandschaften des Nature Writing“:
„Nature Writing ist nicht lediglich ein weiteres literarisches Genre.
Es ist auch kein Trostpflaster für sinnentleerte Großstädter, die in einer idealisierten Natur jene Ursprünglichkeit und Wildheit wiederzufinden suchen, die ihrem Leben abhandengekommen sind.
Nature Writing ist auch ein Spiegel unserer Wünsche und Sehnsüchte. Es entspricht unserem Verlangen, es mit einer Natur zu tun zu haben, die für die Beantwortung der Frage, wie ein gutes Leben gelingen kann, nicht gleichgültig ist. Im Kern geht es also um die Frage, ob das Nature Writing einen Beitrag zu dem Versuch zu leisten vermag, ein modernes Kulturverhältnis zur Natur zu fördern, das nicht länger in so hohem Maße von Missachtung und Ausbeutung bestimmt ist.“
Hiervon kann aber bei Egger keinerlei Rede sein. Wird überhaupt etwas, irgend etwas beredet, beschrieben, beschworen? Letzteres ja. Die Landschaft. Aber nicht als realistisch nachgemaltes Pastell, impressionistisches Aquarell oder als Gartenpanorama. Sondern als pastoses, schier endlos ausgreifendes poetisches Wort-Ereignis. Denn die Lektüre ist mit dem Titel zu beginnen: „Entweder ich habe die Fahrt am Mississippi nur geträumt, oder ich träume jetzt.“ Es ist kein Protokoll einer Wanderung durch eine Landschaft, ein Tal (das „Val di Non“, das Egger im Vorgängerband besang und in den Titel hob?), Gestein, Schründe, Rebenlaub. Vielmehr ist es eine Projektion. Die Projektion eines Traums in Poesie. Achtet man auf die hie und da eingestreuten Begrenzungsverweise, so werden ein Zimmer erwähnt, eine Liegestatt („Halbaufgerichtet im Bett“), ein „Zimmerhorizont“. Eine Zimmer-Reise also ist es; und ein Hinfortwünschen an den Mississippi des Mark Twain, der die Abenteuer von Huckleberry Finn und Tom Sawyer in seinem berühmtesten Roman an diesem Strom ansiedelte. Es ist jemand (Egger? ein Lyrik-Avatar?) in Gedanken unterwegs. Mit Worten. In Wortwellen, Wortschwällen, neuen Anläufen, Sprachüberflutungserhebungen. Nicht weniger. Und mehr kann Literatur nicht sein als: reine Erfindung, die farbschillernde Erfindung der Welt mit allen Sinnen.
Bereits in seinem Langpoem „Herde der Rede“, 1999 im Suhrkamp Verlag erschienen (nicht zu verwechseln mit Eggers Debütband „Die Erde der Rede“, der ein Jahr nach seinem Literatur- und Philosophiestudium herauskam), und seinem Gegen-Stück „Der Rede Dreh. Poemanderm Schlaf“, das Egger, damals noch in Wien ansässig, zeitgleich der Schweizer Edition Howeg anvertraute, war das Außen das Innen. Ein einsamer Dichter liegt auf dem Bett, findet und findet keinen Schlaf und wendet sich der „Herde der Rede“ zu.
Nun ist die Herde evaporiert, verschwunden. Geblieben ist ein Einzelner. Und eine immense Lust an der Sprache, an Melos und Melodie, am Abtauchen zu abgelegenen Wortpreziosen und am Anlandziehen von Neuschöpfungen und Neuprägungen. Da gibt es „flinserdig apere Krateröfen“, an anderer Stelle heißt es: „ins Tropfstein-artig Traubige überlaufende, rieselige Triebsel hingen aus zahllos langen knorpeligen Hornbosteln ins sinkende Felsbassin“. Da liest man von „Stachelsamen“, „Trichter-Rissen“, „Buckelpunkten“. „Abschellerungen“ tauchen auf (und ab) und „wuzelig aufgestaute Eisschollen“. Und Kiesel, „die verpitschelten, ganz überwiegend, bis die Schwere der Verwirbelungen wirtelständig einsinkt in die windstille Schwebe selbst“.
In Textblock 99 findet sich als finaler Satz etwas mutmaßlich Aufklärendes, Erhellendes: „Der Rausch der Farbe ist die Hauptsache.“ Der Rausch, das „Wortdunstklare“ dürfte einer der Schlüssel sein zu den vielen Türen dieses sich stetig verrückenden Wort-Welt-Labyrinths.
Ein Immer-Wieder-Lesebuch liegt hier vor, ein Verirr-Buch mit ironischem? Nachschlagecharakter (was die am Ende der 386 sorgsam durchnummerierten Einträge vorhandenen Pfeile unterstreichen, die auf sinnhaft und/oder atmosphärisch korrespondierende andere Einträge verweisen), dessen Sprachmacht und Sprachselbstermächtigung derzeit in der deutschsprachigen Literatur ebenso exzeptionell wie unverwechselbar anmutet. Im Gegenwartsösterreich dürfte diesem Werk einzig „FAST das Große Haus“, das Hauptwerk des im vergangenen Jahr verstorbenen Dichters Hans Eichhorn, an die Seite gestellt werden.
Und: Entweder ich habe Fahrt am Mississippi … ist ein Buch, auf dessen Wahl unter die schönsten Bücher des Jahres 2021 zu wetten keinerlei Gewinn verspricht – denn es wird definitiv als solches gekürt werden.