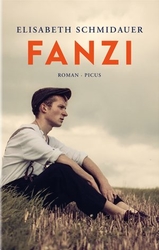Die zwei Stränge, die Schmidauer strickt, sind auf der einen Seite eine zögerliche Liebesanbahnung zwischen Franz‘ Enkelin Astrid und einem Anglisten, der erst bei einem viel späteren Date den Namen Werner bekommen soll. Sie lernen sich kennen, weil der Anglist den Garten des Biologiezentrums, in dem Astrid arbeitet, mit Shakespeare-Bezügen versieht und es bleibt eine langsame, lange Zeit sprachlose Begegnung, die sich durch gemeinsame Unternehmungen wie Wiesenbeobachtungen nach und nach vertieft. Auf der anderen Seite steht die zeitlich viel weiter gefasste Erzählung des Großvaters Franz, dritter und jüngster Sohn eines Bauern, der in Kriegszeiten aufwächst.
Aufgewühlte Vergangenheit
Franz‘ Tage im Heute vergehen von „Dämmerung zu Dämmerung, von Nacht zu Nacht“, und es wird einem etwas düster beim Lesen – ähnlich wie es auch Franz geht nach dem Tod seiner großen Liebe Bärbi. Warum es gar so düster ist und warum Franz‘ Sohn Klaus so dringend etwas von Franz wissen will, es aus ihm herausquetschen möchte, wird von Zeitsprung zu Zeitsprung deutlicher, wenn Schmidauer mit Leichtigkeit Härten beschreibt: Begebenheiten, die man gemeinhin im kollektiven Gedächtnis unter der Kategorie Krieg abgespeichert hat und die unter dieser Kategorie weiterhin gut ruhen. Doch Fanzi rüttelt die Ereignisse neu auf, wühlt im Gedächtnis der Verbliebenen. Es sind zwar bekannte, aber selten mehr erfühlte und erinnerte Geschehnisse, die auch die heutige Düsternis erklären. Der rigide Vater, der Franz‘ Brüder beide zurück an die Front schickt, obwohl sich der jüngere, Leonhard, verzweifelt am Rockzipfel der Mutter festklammert. Die ergreifenden Briefe der Brüder aus dem Krieg, gespickt mit Rechtschreibfehlern und vielleicht gerade deshalb unheimlich authentisch. Die, die zurückbleiben. Der Lehrer, der den Krieg glorifiziert und der Schüler, der Suizid begeht, weil er nicht in den Krieg darf. Die kleine Schwester, die schwer krank wird, sich kaum mehr artikulieren kann und vom Vater in ein Heim geschickt wird. Die Mühlviertler Hasenjagd.
Die Landschaft mit Farben anstreichen
Wenn etwas nicht benennbar ist, dann muss man es eben erzählen. Manchmal hilft die Natur auf die Sprünge, ähnlich wie an einem frühen Sommermorgen der junge Franz über die Wiesen hüpft: „Eine Freude war in ihm gewesen, die herausspringen wollte; er hielt sie aber zurück und trug sie, sachte, in der Brust.“
Lange währt das Geheimnis, warum die Geschichte vom Opa Franz am Ende so heißt, wie ihn seine kleine Schwester Elfi immer genannt hat, warum die Geschichte am Ende doch wieder von Elfi ausgeht. Die kleine Elfi wurde im Schloss Niedernhart ermordet, ebenso wie unzählige andere Kinder und Jugendliche, unter dem Begriff „Euthanasie“ gerechtfertigt, zwischen 1940 und 1944 in den Schlössern Niedernhart und Hartheim in der Nähe von Linz ermordet wurden, dem Roman hängt eine Gedenkliste der ermordeten Kinder und Jugendlichen an. Insgesamt wurden allein in Hartheim fast 20.000 Menschen getötet. Franz fühlt sich lange verantwortlich, er hat seine kleine Schwester nicht beschützt, sein Schmerz manifestiert sich und trägt sich, wie so oft, weiter von Generation zu Generation. Erst gegen Ende seines Lebens schafft er es, seine Schuld an- und auszusprechen und Geschichten ans Licht zu bringen, die er jahrelang mit sich herumgetragen hat. Nur seine Frau Bärbi, früher einmal beste Freundin von Elfi, hatte davon gewusst.
Die Schwere dieser Familiengeschichte ist aus der Sprache nicht abzulesen. Sie wird getragen von Beistrich zu Beistrich, streicht die Landschaft mit getönten Farben an: Der Morgen ist blau, die Luft grau.
Was ist ein Täter, wer trägt Schuld? Warum sollten auch die nächsten Generationen noch persönlich nehmen, was damals passiert ist und bis heute tief drin sitzt in den Menschen? Elisabeth Schmidauer gräbt behutsam die Vergangenheit um, sie hat ein Buch geschrieben, das nicht laut ist und nicht schreit. Aber es fragt nach, Sohn Klaus verkörpert das Fragen, unangenehm, aber unerlässlich. Die Orte sind es, die bleiben, die stetig erinnern und an die wir zurückkehren. Die Frage „Was habt ihr getan?“ verhallt in Fanzi schließlich in der grausam-schönen Landschaft.