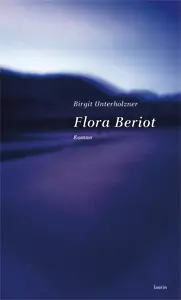„Jakobs Tod war weder Krankheit noch ein Unfall. Er war eine Sehnsucht,“ wird sie Jahrzehnte später auf Vincent Merz‘ Frage nach der Todesursache erwidern. Der Schriftsteller will eine Biografie über die Tochter Jakob Beriots schreiben. Eines Tages stand er plötzlich in Floras Goldschmiede. Ob er ab und zu vorbeikommen dürfe? Sie solle erzählen, er werde mitschreiben. „So fing alles an.“
Szene für Szene reiht Flora ihre Erinnerungen aneinander, Momente einer Reise in die eigene Vergangenheit, einer Suche nach dem Vater, nach Erklärungen für seinen Tod. „Selbstmörder ist man lange bevor man sich umbringt,“ schreibt Jean Améry 1976 in seinem Essay Hand an sich legen: „Wasser an den Beinen, Wasser, das langsam steigt, zur Brust, über sie hinaus, an die Lippen. Der Kopf wird noch eine Weile oberhalb der Wellen bleiben wollen, voll bis zum Zerspringen von gurgelnder Flutenmusik. Bis er verschwindet, und was die Leute dann an den Strand ziehen, ist eine Sache, une chose, kein ‚Ertrunkener‘, sondern ein Etwas, das mit Mensch und Ich nichts mehr zu tun hat.“ „Tagelang streunte ich durch die Gassen meiner Stadt, denn ich hatte Jakobs Gesicht verloren,“ erzählt Flora. „Nie hörte ich auf, mir einen Vater zu erfinden.“ Und mit ihm mich selbst.
Vaterlose Töchter sind Geschichtenerzählerinnen, Vatergeschichtenerfinderinnen, so scheint es: Pippi Langstrumpf, Marilyn Monroe, Flora Beriot. Ihr Erzähltalent ist dabei Ausdruck eines Mangels. Denn viel mehr als die Erinnerungen aus zweiter Hand haben sie nicht. Entsprechend kostbar sind die Episoden und Augenblicke, in denen die Idee oder das Bild des Vaters auftauchen. Flora erzählt Jakobs Geschichte, die vor ihrer Zeit stattgefunden hat und die sie nur vom Hörensagen kennt: „Den Erinnerungen Gabriellas widersprach ich nicht. Nein. Das tat ich nie. Ich hörte zu.“
Doch das Kapitel ihrer eigenen Suche muss Flora selbst schreiben, sie muss auskundschaften, welche Bedeutung der abwesende Vater für sie hat, welche Rolle er in ihrem Leben spielt. Vieles muss sie sich zusammenreimen: Familienverhältnisse, gefährliche Liebschaften, Geschichten von „Glanz und Verlust“. „Solange ich erzählen kann“ und „Nicht den Faden verlieren“ lauten zwei Kapitelüberschriften des Romans. „Die Wirklichkeit lässt sich übers Erzählen zurechtrücken. Das hat mir das Leben beigebracht,“ sagt Flora. Doch die Erzählungen der anderen, Gabriellas und Vincents, bringen das fragile Gleichgewicht wieder ins Wanken.
„Letztlich führen alle Reisen ins Innere der Figuren.“ zitiert der Klappentext die Zeitschrift Brigitte. Nun birgt diese Kultur der psychologischen Innenschau auch Gefahren: Nicht von ungefähr gilt Sentimentalität in Form einer kitschigen, falschen Innerlichkeit als eines der Hauptmerkmale von Trivialliteratur. Auch Birgit Unterholzner lädt ihre Sprache allzu sehr mit Bedeutung auf; die Ernsthaftigkeit ihres Tonfalls schrammt manchmal nur knapp am Pathos vorbei, die wehleidige Selbstgefälligkeit und mangelnde Distanz der Figuren zu sich selbst stoßen sauer auf. Zudem stören Stilblüten, verunglückte Metaphern und Vergleiche und ein Hang zum Esoterischen das Lesevergnügen.
Es bleibt abzuwarten, was Birgit Unterholzner in Zukunft vorlegen wird. Das feine Gespür der Autorin für ihre Figuren und die souveräne Gestaltung der Handlung ihres Debütromans versprechen jedenfalls mehr.