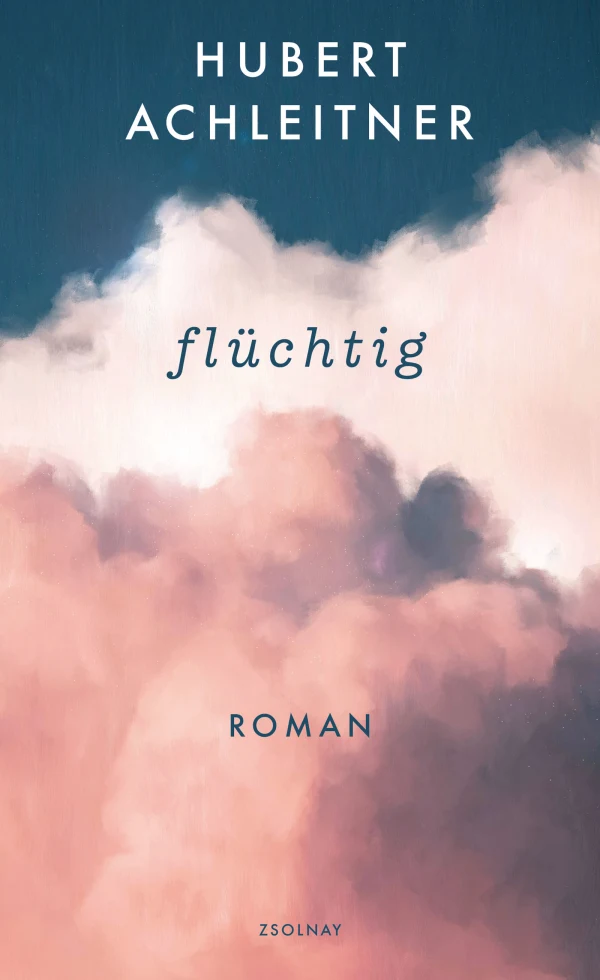flüchtig erzählt vordergründig eine recht gewöhnliche Geschichte. Maria, Bankangestellte, seit 30 Jahren verheiratet mit Herwig, einem Lehrer für Geographie und Musikerziehung an einer Schule im Salzkammergut, verlässt eines Tages ihren Mann, kündigt ihre Anstellung und begibt sich zunächst ziellos auf eine Reise, die sie in die Alpen zu einem etwas aus der Zeit herausgefallenen Hippietreffen und schließlich nach Griechenland führt. Dem vorausgegangen war eine Fehlgeburt, die Maria und ihre Beziehung zu ihrem Mann Herwig schwer belastete, sowie eine Affäre ihres Mannes mit der Norwegerin – dem „Nordlicht“ – Nora, die schließlich ein Kind erwartet. Herwig, der sich große Sorgen um Maria macht und zunehmend erkennt, dass ihre Liebe, ihre Beziehung noch eine Chance haben sollte, beginnt sie zu suchen und macht sich – begleitet von seinem Vater – ebenfalls auf die Reise.
Beginnen lässt der Autor diese Reise bereits mit Marias Geburt, ein seltsames, ein „unerhörtes“ Ereignis, er schickt Marias Mutter mitten im tiefsten Winter in die Berge. Bei Sturm und Schneefall und minus 17 Grad in einer Gondel ins Tal abwärts fahrend, „hoch über den Felsen schaukelnd, vom Sturm gerüttelt, als würde ein Dämon sie in den Abgrund schleudern wollen (…) brachte sie ihr Kind zur Welt und nannte es aus Dankbarkeit an die weibliche Heilige Dreifaltigkeit: Eva Maria Magdalena.“ (S. 16). Diesem aufregenden Auftritt in der Welt folgt eine unspektakuläre Kindheit und Jugend in einer „kaiserlichen Kurstadt“ – und ein weiteres überraschendes Ereignis: der Tod ihrer Eltern durch eine Pilzvergiftung, mutmaßlich verursacht durch den Vater, der kurz zuvor von der Affäre seiner Frau mit seinem besten Freud erfahren hatte.
Zwischen zahlreichen kleinen Episoden und Ereignissen entspinnt sich das Leben von Maria und Herwig, die sich in Salzburg nach einer Vorstellung von Mozarts Zauberflöte bei den Salzburger Festspielen verlieben, eine glückliche Zeit miteinander verbringen, ohne zunächst wahrzunehmen, dass die Beziehung – schon vor der Fehlgeburt – aus dem Gleichgewicht gerät. Nach diesem für beide traumatischen Ereignis zieht Maria sich vollkommen zurück, beginnt eine Affäre. Herwig reagiert mit dem Konsum von Marihuana und Alkohol und verliebt sich in Nora. Schließlich setzt sich Maria in Herwigs Auto und fährt mit der zufällig aufgelesenen Reisebegleiterin Lisa bis nach Griechenland, wo beide mit Ioannis einen leidenschaftlichen Sommer verleben.
So unstet wie die beiden, Lisa und Maria, unterwegs sind, so unstet, so indifferent, so wechselhaft, seltsam unausgereift und direkt wirkend ist auch die Sprache der Figuren: einmal voller poetischer Wendungen, dann wieder klischeehafte Alltagssprache. Herwigs und Marias Sprache ist ebenso wie ihre Beziehung banal und erhaben zugleich. Sätze wie „Reden war nicht ihr Ding.“ (S. 12) oder „Damit war die Sache gegessen.“ (S. 13) stehen neben dialektal gefärbten Phrasen und Austriazismen wie „er riss einen fürchterlichen Stern“ (S. 27), „es war ihr wurscht“ (S.46), aber auch scheinbar Kalenderblättern entlehnten Sinnsprüchen wie: „Aus dem zarten Pflänzchen aus der Familie Skepsis war ein ausgewachsener Baum der Gattung Resignation geworden.“ (S. 37). Daneben lässt Achleitner seine Figuren poetisch „mit der richtigen und gleichmäßigen Gewichtsverlagerung, allein mithilfe der Schwerkraft und der Fliehkräfte durchs Leben schweben“ (S. 28), während Worte wie „krass“ und „geil“ (S. 98) zu Lisas Wortschatz gehören. Das irritiert mitunter, vor allem dann, wenn die Erzähldistanz aufgegeben wird und unklar ist, wer hier denkt, spricht und handelt.
Der Text ist durchzogen von zwei wiederkehrenden Symbolen, die die Reisenden begleiten und in unterschiedlicher Funktion eingesetzt werden: Musik (samische Gesänge oder die Tradition der Sepharden, griechische Volksmusik, Lieder von André Heller und Leonard Cohen, Blues und der große griechische Komponist Mikis Theodorakis) durchzieht den gesamten Text, ohne dabei eine dramaturgische Funktion zu haben. Die Liedtexte, Anklänge, musikalischen Andeutungen untermalen die Stimmung und stellen Atmosphäre her. Hingegen ist der Berg, sind Berge Heimat- und Zufluchtsorte, Schutzzonen, mitunter auch Bedrohung und unerreichbare Sehnsuchtsorte gleichermaßen und von Beginn an nicht nur Schauplatz, sondern gleichsam auch Spiegel der Handlung. Dass ein Berg auch Endpunkt der Reise ist, überrascht daher nicht. Eine Textstelle aus Christoph Ransmayrs Roman Der fliegende Berg begleitet dann auch einen entscheidenden Moment in Marias Leben.
Eingefasst ist diese Geschichte in eine Rahmenhandlung, in der der Icherzähler die Perspektive von Marias Begleiterin Lisa einnimmt, die zu Beginn des Textes festhält: „Die Namen dieser Geschichte habe ich frei erfunden, auch den für mich. Ich heiße in diesem Buch Lisa.“ Damit wird die Geschichte, die so voller realer Orte, realer Ereignisse und konkreter Begebenheiten ist, eben dieser Sphäre enthoben. Und weiter: „Darüber hinaus gebe ich die Dinge genau so wieder wie sie geschehen oder da, wo ich nicht dabei war, wie sie mir berichtet worden sind, das meiste von Maria selbst.“ Und sie bekommt dokumentarischen Charakter, der durch den Abdruck zweier Briefe unterstrichen wird.
Hubert Achleiter ist als Musiker ein engagierter Künstler, ein Künstler, der die Aufmerksamkeit und sein musikalisches Schaffen oft auf das Stille, das Unbemerkte legt, auf jene, die weit entfernt von der Weltöffentlichkeit eine reiche musikalische Tradition leben, der sich für junge Musikerinnen und Musiker engagiert und einen – seinen – von großem Humanismus und Menschenliebe getragenen Standpunkt vertritt. Und er schreibt ein Buch, das so ganz das Innere zeigt, die Liebe zweier Menschen an einem entscheidenden „flüchtigen“ Wendepunkt: „Im Leben ist es wichtig das zu sehen, was im Augenblick da ist. Dann hält man inne – und geht irgendwann weiter. Auch darauf kommt es an: Auf das Weitergehen!“ so der Autor und Musiker. Aufmerksam sein, kritisch beobachten, weitergehen, nicht stillstehen, das ist es, was heute – im Mai 2020 – wichtig ist, vielleicht mehr als je zuvor.