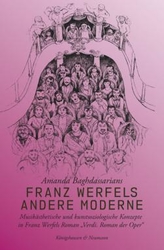Es ist eine Moderne, die sich die Rationalität nicht glaubt, sich als Intention einer ratio (gen. subj./obj.) durchschaut, als Intentionalitäts- bzw. Souveränitätsexerzitie an einer „Welt als Wille und Vorstellung“ (S. 47), wie die Autorin es mit Schopenhauer formuliert. Mit dem Sinn für diese Charakterisierung versteht Baghdassarians, was die Sekundärliteratur oft verkannte: Werfel hängt nicht einer Nostalgie vor der Folie missglückter Aufklärung nach, vielmehr ließe er sich kohärenter in einer Reihe mit jenen sehen, die die Moderne modern revidieren.
Werfels Verdi-Bild, das im Zentrum der Untersuchung steht, zeigt das bestens. Dabei hat die Verfasserin auch die Musikliteratur genau unter die Lupe genommen, etwa, wenn – modern oder antimodern? – von „einer musikalischen Volksversammlung“ (S. 51) die Rede ist, die aber nicht vom erhabenen Klang eingelullt wird, sondern eine Aufgabe darstellt: Man komponiere „auch […] ein ideales Bild des Raumes und der Hörerschaft“ (S. 52), so Bekker in Die Sinfonie von Beethoven bis Mahler. Aus derlei Prämissen, die Werfel teils inspiriert haben mögen und teils verstehen helfen, arbeitet man sich zum Text selbst, der kontextualisiert und schließlich einer peniblen Lektüre unterzogen wird.
Dieser Text dementiert fast, dass es auf den Text ankomme: „Wozu Sätze aus vielen Worten, die doch niemand verstehen konnte, wenn Musik sie trug.“ (S. 95) Diese Frage oder eher Feststellung leitet die Untersuchung ein, ob „der Musik […] eine eigenständige Bestimmung“ (S. 98) zukomme. Was aber wäre ein Text, wenn es „die Idee einer absoluten Musik“ (S. 104) nicht gibt, einer Qualität, die den Text von dem diskursiven Potenzial seiner Wörter sozusagen abhebt? Und zugleich ist es der Diskurs, worin Autor und Leser einander umschleichen, wie es Werfel imaginiert:
„Die Bewußtseinsstufe der szenischen Welt darf nicht identisch sein mit der Bewußtseinsstufe der Zuschauerwelt. – Wir müssen immer etwas mehr oder weniger wissen, oder ahnen, sonst langweilen wir uns.“ (S. 110)
Langeweile meint dabei, dass „dramaturgische Erkenntnisse zu gewinnen“ (S. 120) sind – dies das Ziel jedenfalls Werfels und dann auch Kurt Weills. Dieses Moment überschreitet Musiktheater und Drama bis zu Döblins Romanschreiben, dessen „opernästhetische Kriterien“ (S. 138) Baghdassarians überzeugend einführt. Dabei sind Autor und Leser einander darin ähnlich, dass sie etwas aus dem vernehmen, das der Autor schreibt oder im Schreibprozess so vernimmt, dass er weiterschreiben kann: Verdi muss bei Werfel im Rahmen einer Schreibblockade erkennen, „daß er mühsam erdichten wollte, was nicht da war, anstatt wie früher nur zu erlauschen und festzuhalten, was ihn herrlich durchdrang.“ (S. 176) „Inspiration“ und „Exspiration“ (S. 178) sind hier, wiewohl zweitere eigentümlicherweise „wichtiger“ (S. 178) sei, fast identisch.
Am Ende zeigt sich durch derlei Problemexpositionen und Lektüren hindurch in der Tat, dass die Germanistik Werfel als einen Proponenten einer „»reflektierten« Moderne“ (S. 213) verkannt haben dürfte, anders als Musil, Döblin oder Broch stelle er doch Fragen, die deren Ansätzen verwandt sind, gegen den „naiven Ammenglauben“ (S. 213) gerichtet, der die Moderne zu werden droht, wo sie ihr Programm für vernünftig halten will. Der Moderne bedürfe es, aber als etwas, das die Absetzung von ihr gestattet – dazu dürfe sie nicht „too fragmented“ (S. 9) sein, wie einleitend mit George Michael festgehalten wird. Aber sie wird auch keine ganze.
Ob Werfels Antwort, die in der Folge u.a. Freud „geradewegs zum Mystiker, der den geistigen Schlüssel des modernen Menschen gefunden“ (S. 222) habe, macht, nicht doch jener Vernunft aufsitzt und ob sein Werk dem Rechnung trägt, was es und Werfel als Theoretiker als Anspruch formulieren, das bleibt schließlich zwar offen, doch der Einspruch Baghdassarians‘ gegen eine Auffassung von Werfels Schaffen als einer „regressive(n) Bewegung“ mit „restaurative(n) Tendenzen“ (S.258) zuzurechnendem ist verdienstvoll. Man kann die vorliegende Studie Interessierten nur ans Herz legen.