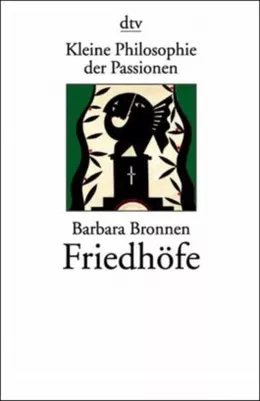Ganz im Sinne des sogenannten „Begräbnismimen“, der im alten Rom beauftragt war, dem Trauerzug bei Begräbnisfeierlichkeiten vorzustehen und die wichtigsten Szenen aus dem Leben des Verstorbenen darzustellen, berichtet und reflektiert Bronnen über Schicksale von Dichtern, Widerstandskämpfern, ermordeten Juden, unbekannten Soldaten oder schlicht von anonymen Toten.
„Der Friedhof als Bühne des Lebens“ (S. 10) rührt dabei an der Vorstellung, Theater hätten alleine im Schatten von Begräbnisstätten ihre dramaturgische Berechtigung. Und tatsächlich erinnern die Überlebenden (= Schauspieler) durch ihr bloßes Dasein beim Friedhofsspaziergang (= Aufführung) an das Vergangene und Begangene (= Gräber). Dieser Gedankengang führt trotz der redlichen Bemühungen Bronnens, die dargestellten, teils erfundenen und teils einfach nur angedeuteten Lebensgeschichten möglichst in ihrer Allgemeinheit nicht zu vergessen, zu der Vermutung, daß sie immer wieder nur sich selbst besucht, wenn sie zu den Toten geht.
In Begleitung der (verstorbenen) Großmutter kommt der Autorin der Lebensnutzen besonders eindringlich zu Bewußtsein: Das Dasein ist kein Eigentumsverhältnis, sondern einzig von provisorischer Nutzung; und trotzdem fällt es uns schwer, „die Bedingungen zu akzeptieren, unter denen wir auf die Welt gekommen sind […]“ (S. 119).
Jene erklären sich erst aus dem Tod, während letzterer wie kein anderes Ereignis im Leben radikal an den Beginn von allem zurückverweist. Dieses altbewährte Spannungsverhältnis gibt Bronnens Buch von der ersten Seite an den (hohen) Ton vor, auf den ihre Prosa ein wenig wehmütig gestimmt ist.
Dazwischen reduziert sich der Erlebnisgehalt der vorgeführten, zum Teil aus wenigen Daten entwickelten Biografien auf ein Zwiegespräch mit den Toten, das augenscheinlich den antiken Topos von der Rede mit den Verstorbenen bemüht. Gleichzeitig bedingt diese Erzähltechnik eine Reflexion auf das Medium selbst: „Zum Glück gibt es die Literatur, die das Leben bewahrt“ (S. 85). Bronnen (und mithin auch der Leser) hat also gelernt, „[…] daß es eine Übersetzungsmöglichkeit gibt. [Sie reduziert] nicht mehr das, was [sie sieht], auf Anonymität“ (S. 91), sondern erhöht das eigene Leben auf das eines anderen, oder auch auf das, was niemand erlebt hat.
Stille Schau-Plätze dabei sind berühmte Friedhöfe wie der Pariser Père Lachaise, der Venezianische San Michele oder der Alte Nördliche in München. Der Dorotheenstädtische in Berlin, wo Bronnens Vater, der Schriftsteller Arnolt Bronnen, begraben liegt, hat schließlich durch die gefühlvolle, aber zu späte Auseinandersetzung mit der Herkunft der Autorin letztgültigen Verweischarakter.