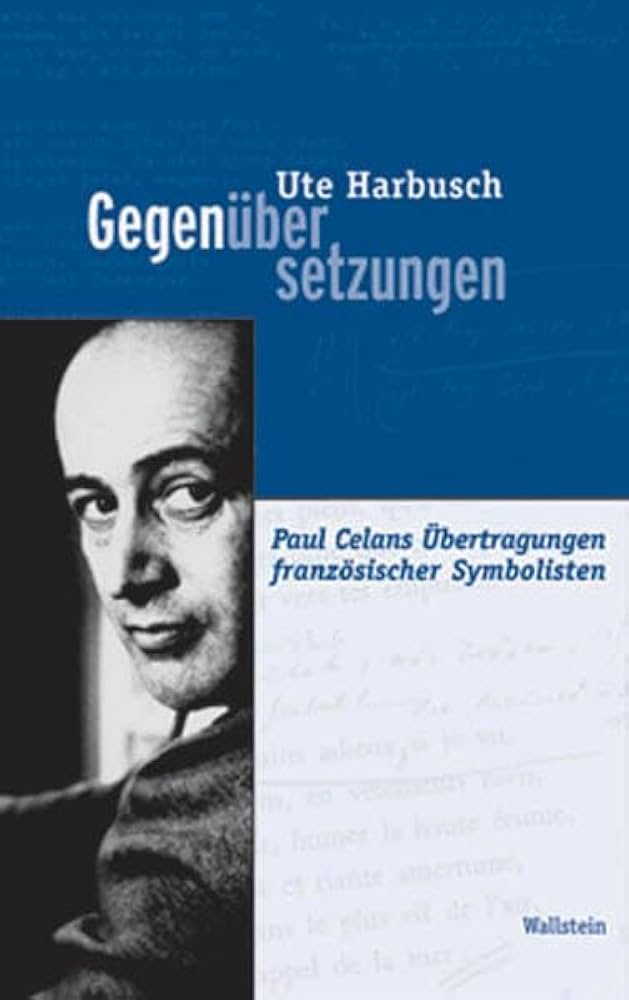Der Titel ist kurz, prägnant und präzise mehrdeutig. Seit langem bekannt und anerkannt ist die Bedeutung der Übersetzungen Celans innerhalb seiner literarischen Arbeit. Die französischen Autoren wurden dabei gegenüber den russischen – vor allem Ossip Mandelstamm – ein wenig vernachlässigt. Wenn Celan die Werke anderer Dichter übersetzte, konnte dies aus Freundschaft und einem Empfinden von literarischer, mitunter auch menschlicher Nähe geschehen. In anderen Fällen sind die Übertragungen eher analytisch, Celan scheint es darum gegangen zu sein, eine bestimmte Poetik genau zu untersuchen, um sie sich entweder – vielleicht nur partiell – anzueignen oder auch, um ihr etwas Eigenes entgegenzusetzen. Harbusch macht alle diese Möglichkeiten und die Nuancen dazwischen sinnfällig und versucht, die Wechselbeziehungen zwischen Celans übersetzerischem Tun und seinem eigenen Werk sowie den Stellenwert etwa der Rimbaud- und Valéry-Übersetzungen (neben denen von Mandelstamm) innerhalb der Entwicklung seiner eigenen Dichtung zu bestimmen.
Die Ergebnisse lassen sich nicht auf einen einzigen Punkt, wohl aber in eine überschaubare Anordnung bringen. Deutlich wird im Verlauf von Harbuschs Analysen, daß Celans Werk in einem Spannungsfeld steht, also von einer Mehrzahl von miteinander verbundenen Spannungen gleichsam regiert wird. Ein wenig poetisch formuliert könnte man sagen, daß seine Lyra aufs äußerste gespannt ist, so daß die Saiten immer wieder zu reißen drohen. Dennoch kann der Sänger nichts anderes tun, als sein Instrument diesen Spannungen auszusetzen. Wenn es zutrifft, daß Celans Gedichte den (schwierigen, wo nicht unmöglichen) Dialog suchen, dann drängt sich die Beobachtung auf, daß die Tätigkeit des Übersetzens von der Seite eines zunächst nur Aufnehmenden her eine ausgezeichnete Form des Dialogisierens ist: das Geschenk wird durch eine Gegengabe unmittelbar erwidert. Andererseits hat sich Celan, was die französische Dichtung betrifft, besonders für monologisierende Gedichte interessiert, die den Dialog mit einem Du und den Bezug zu einer Welt außerhalb ihrer selbst tendenziell kappen. Das gilt besonders für Mallarmé und für Paul Valéry. In den Übertragungen wiederholt Celan insofern die Paradoxie seiner eigenen Poetik.
Von diesem ersten Befund aus zieht Harbusch nun weitere Kreise, um die Problematik der von Celan immer wieder beanspruchten und gerechtfertigten Dunkelheit des Gedichts zu erhellen. Hier kommt sie, sehr spät, nach über vierhundert Seiten, auch auf einen biographisch-existentiellen Zusammenhang. Sprachliche Dunkelheit wird nun nämlich als Todesnähe erfahrbar und die Rolle des Dichters der des Orpheus vergleichbar, der den Austausch mit der Unterwelt suchte. Celans Beschäftigung mit der „jungen Parze“ (La jeune Parque), einem monolithischen Spätwerk jenes Autors, dessen Poetik in mancher Hinsicht seiner eigenen diametral entgegensteht, wird letztlich durch die im französischen Gedicht enthaltene Spannung zwischen Licht und Finsternis, zwischen Lebens- und Todestrieb verständlich. Dichtung als Wirklichkeitssuche angesichts des Abgrunds, der vollkommenen Ungewißheit, die sich auch auf die Sprache und ihre Gebrauchbarkeit erstreckt; und das einzelne, fertige, veröffentlichte Gedicht als dunkles, undurchschaubares Zeichen, das sich jedem hermeneutischen Zugang entzieht (aber dennoch, wie Harbusch zeigt, noch in seiner Unzugänglichkeit beschreibbar bleibt). Eine der Spannungen, in denen Celans Dichtung steht, ist die literaturgeschichtliche, zwischen der autonomen, ausschließend-selbstbezogenen Artistik, auf die die künstlerische Entwicklung, wenn man von einer solchen sprechen will, zuzusteuern schien wie Rimbauds trunkenes Schiff, und dem Sich-Geben einer persönlichen Stimme (mit einem individuellen Schicksal, einem Werdegang), das in einer immer nur individuellen Begegnung stattfinden kann.
Es gehört wohl nicht zu den Aufgaben einer Studie wie dieser, Übersetzungskritik zu treiben. Immerhin referiert Harbusch kritische Beiträge, die auf Celans Veröffentlichungen, besonders auf die „Junge Parze“, reagierten. Manche Einwände, übrigens immer mit dem größten Respekt vorgetragen, sind nachvollziehbar. Die „Junge Parze“ war sicherlich eine Gewaltleistung, der man den versteckten Wunsch ablesen kann, das Original zu zerstören – und sie dennoch zu retten, herüberzuretten. Harbuschs Buch ist nicht der Ort, um Fragen nach den Möglichkeiten und Unmöglichkeiten von „Entsprechung“ – nicht nur über die Sprachen, sondern auch über die Zeiten hinweg – zu beantworten. Aufgeworfen werden sie unweigerlich: das liegt im Wesen von Celans poetischen Übertragungen.