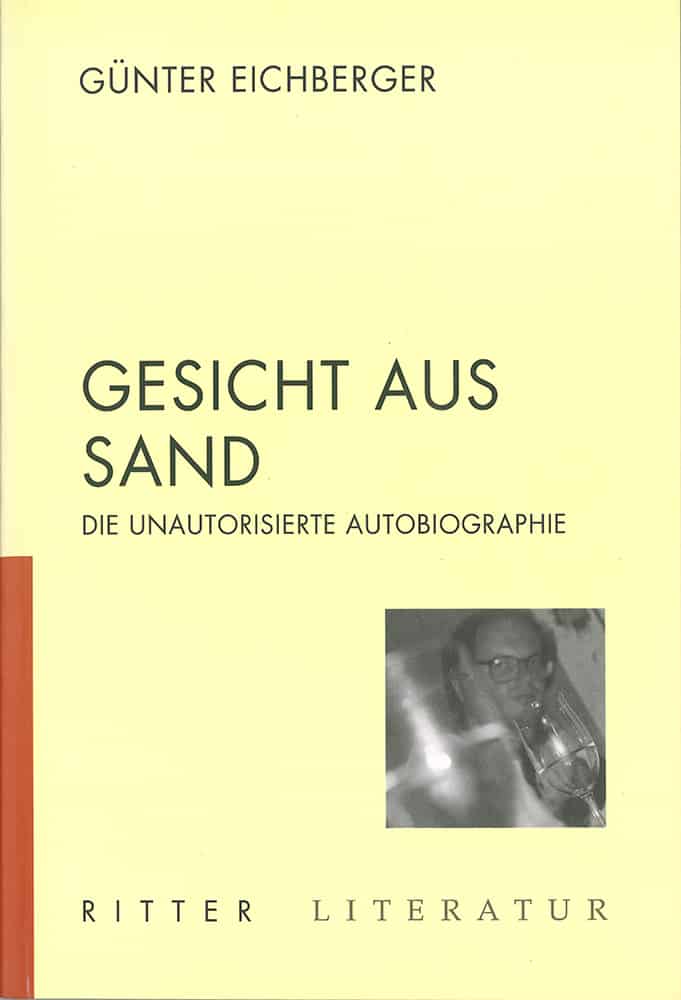Aufgeknäuelt ist der Ariadnefaden, der bei Eichberger durch die Spiegelwelt der Sprache führt, erneut im jüngsten Prosabuch Gesicht aus Sand. Die unautorisierte Autobiographie., so der Untertitel, stellt – unter den Vorzeichen der strikten Unbeantwortbarkeit – in phantasmagorischen Szenefluchten wieder Fragen nach Ich und Wirklichkeit sowie der literarische Realisierung des Ich.
Gesicht aus Sand wirkt, als wären Groucho Marx, Woody Allen und die Monthy Pythons – die genannten treten auch alle im Buch auf – gemeinsam an einer fiktiven Autobiographie eines erfolgreichen Schriftstellers gescheitert. Der Grundtenor des Buches: Selbst wenn Leben, Leiden, Liebe irgendetwas Fixes und Unumstößlich an sich hätten – beschreibbar wäre es auf keinen Fall. Und so exerziert Eichberger seinen Lesern einmal mehr vor, welchen Schimären der Mensch in der zeichenhaften Welt aufsitzt. Dass der Autor von sich behauptet, zum Zeitpunkt der Niederschrift bereits tot zu sein, ist dabei nur eine unter vielen Irritationen, die das Vexierspiel um Wirklichkeit und Abbildung auslöst. Dabei, so Eichberger in einem Gespräch, das im Folgenden auszugsweise wieder gegeben ist, zähle „Gesicht aus Sand“ noch zu seinen weniger grotesken Texten.
Was sich bei der Lektüre Deiner Texte aufdrängt, ist die Frage nach dem Biographischen. Was fasziniert Dich an Biographien und Porträts?
Der Ausgangspunkt für Gesicht aus Sand war, Materialien zu einem Lebenslauf zu sammeln. Ich bin davon ausgegangen, dass man sich selbst literarisch entwerfen kann. Dass man ein imaginäres Selbstporträt machen kann. Weil über mich, in einem konkreten oder alltäglichen oder realistischen Sinn, schreibe ich ja so gut wie nie. Ich versuche immer, jemanden zu erfinden, den nenne ich Ich, und wie viel das jetzt mit dem Eichberger als konkreter Person zu tun hat, das ist gar nicht so leicht zu entscheiden. Auch für mich nicht.
Ich wollte auch diesen Irritationseffekt erzielen, dass der Leser nicht weiß, was wurde erfunden, was beruht auf „Erfahrung“? Und das Erfahrene und das Erfundene, dieser Unterschied wird im Buch aufgehoben. Um das ist es mir gegangen – das Authentische zu parodieren, dieses Konzept des Authentischen, dagegen bin ich ursprünglich sehr stark angegangen.
Was stört Dich am Konzept des Authentischen?
Ich glaube, dass es schlichtweg nicht funktioniert. In dem Moment, wo du beginnst, über etwas zu schreiben, findet schon von der Sprache her eine derartige Stilisierung statt, dass das einen Eigencharakter gewinnt, eine eigene Wirklichkeit wird, die sich von dem Beschriebenen zwangsläufig entfernt. – Der Effekt beim phantasmagorischen Schreiben ergibt sich ja daraus, dass jemand den Unterschied zwischen einer empirisch wahrnehmbaren Wirklichkeit und einer Fiktion kennt. Wobei, wenn man dann genauer hinschaut, finde ich, dass die Menschen sehr stark in Vorstellungen leben. Nicht nur die professionellen Erzeuger von Fiktionen, sondern auch die anderen. Das sieht man sehr oft. Selbstbilder kommen mir immer wahnhaft vor. Und wenn die Menschen durchdrehen, wenn sie wahnsinnig werden, dann sieht man, wie die Vorstellungen sich verselbständigen, und wie dominant die Vorstellungen im Bewusstsein eigentlich immer sind.
Vieles von dem, was Du als mögliche Biographie entwirfst, ist dermaßen absurd, dass es als Erweiterung des Möglichkeitssinnes erscheint: Der Unmöglichkeitssinn.
„Unmöglichkeitssinn“ – so heißt auch ein Kapitel in meinem ersten Buch „Der Wolkenpfleger“. Da habe ich das überhaupt auf die Spitze getrieben, während ich bei „Gesicht aus Sand“ in einem Rahmen bleibe, der zwar grotesk ist, aber für meine sonderbaren Begriffe gar nicht ins Totale geht. Es ist alles mögliche davon eigentlich erlebbar, also nicht nur unmöglich, nicht nur phantasmagorisch. Es wird der Hauptfigur sehr übel mitgespielt, und das gibt es bei Künstlerbiographien auch. Bei mir ist das der höhnische Bezug auf das Authentische, wo der Marktwert oder der Name des Künstlers oft genau an sein konkretes Erleben geknüpft ist. Ob das Jean Genet ist, der eingesperrt war, oder Jack Unterweger, wo sich die Begabung meines Erachtens im ausgelebten Sadismus erschöpft hat. Da gibt es viele Anspielungen auf konkrete Künstlerschicksale. Die werden halt übertrieben oder überzeichnet.
Deine „Autobiographie“ ist aus einer schier rauschhaften Abfolge von Szenen aufgebaut. Wie ist Dein Verhältnis zum Rausch?
Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zum Rausch. Von meinen ersten Rauscherlebnissen weiß ich heute, dass sie durch Endorphine ausgelöst worden sind. Und zwar ist das durch Schreiben passiert, durch stundenlanges Schreiben, wo ich in eine Art Rauschzustand hineinkam. Das Schreiben hat mich immer stark euphorisiert. Das ist heutzutage nicht mehr ganz so, weil ich halt konzentrierter oder professioneller arbeite, weil ich einfach alt und ausgelaugt bin, wahrscheinlich – nein -, aber das war als Kind sehr stark. Ich glaube auch, dass ich deswegen weitergemacht habe, immerfort und ohne je wirklich aufzuhören. Weil es einfach so ein tolles Gefühl erzeugt, wo man sich auch sagen kann: was kümmert mich das Bestehende, wenn ich auch diese Möglichkeit über das Gehirn habe.
Mit Günter Eichberger sprach Werner Schandor.