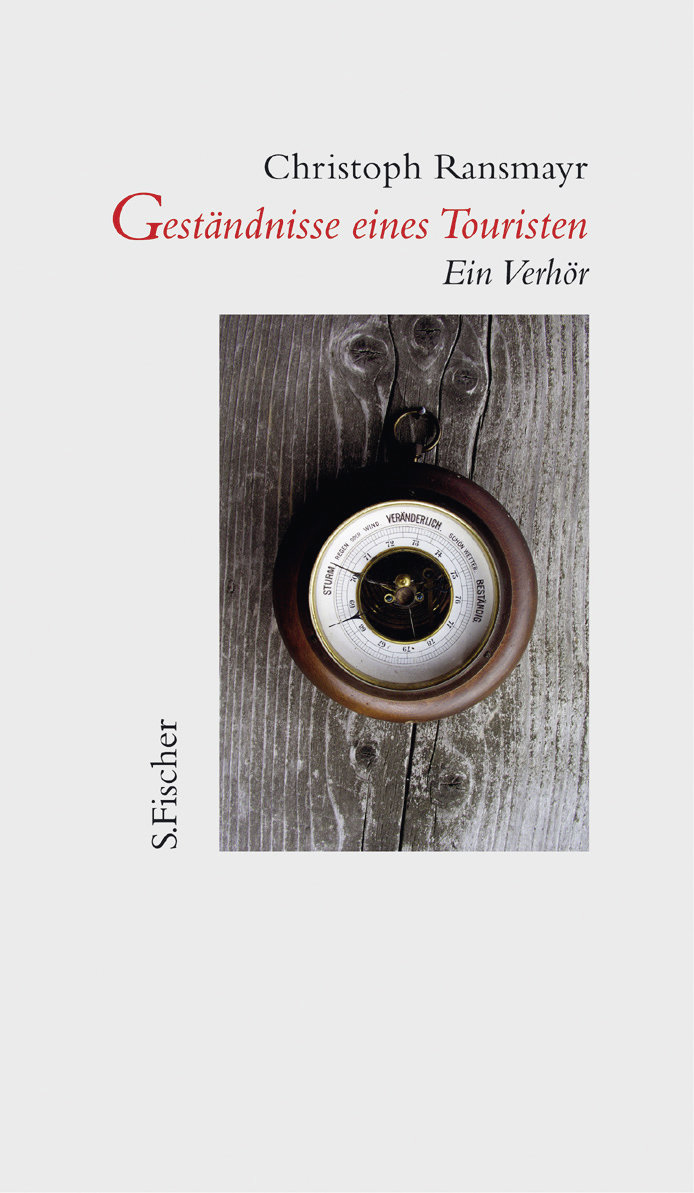Solche Werkstattgespräche bieten vor allem Kollegen und Fachleuten Erhellendes. Wer nicht gewillt ist, mit dem Schriftsteller über das Wunder der Dichtkunst nachzusinnen, der mag sich an den Exkursen in die bunte Bilderwelt des Globetrotters und Halbnomaden gütlich tun. Denn Ransmayr ist weit gereist und süchtig nach Eindrücken und Geschichten. Vielleicht ist es gerade diese Neugier, die ihn mit seinem Freund Reinhold Messner verbindet und ihn anspornt, auf seinen Touren die Horizontale mit der Vertikalen zu vertauschen, gleichsam um an den entlegensten Plätzen der Erde einen forschenden Blick auf die „conditio humana“ zu werfen.
Ransmayrs existenzielle Maxime lautet konsequenterweise „Auf und davon“ und verweist auf die enge Beziehung zwischen Reisen und Schreiben, zwischen Gehen und Denken. Insofern lesen sich die Geständnisse eines Touristen auch als ein Plädoyer für die Fußwanderung als die dem Menschen gemäße Form der Fortbewegung.
Er halte sich für keinen Abenteurer. Nur wer ein langweiliges Leben führe, suche den Nervenkitzel, sagt Ransmayr, sagt Messner, möchte man hinzufügen. Aber wozu Spurensuche betreiben? Dies sei das Geschäft der „Heimwerker und Hausdurchsucher“, wie der Österreicher die Literaturwissenschaftler und allzu Neugierigen bezeichnet.
Es werde daher auch keinen Nachlass geben, behauptet er. Ebenso wenig sei er bereit, mit Kommentaren zu seinem Werk aufzuwarten. Doch da nimmt er sich schon zurück und gibt überraschend Auskunft über seine Romane. Morbus Kitahara spiegelt jenseits des abgezirkelten narrativen Raums auch Ransmayrs Vergangenheit wider. In seinen Texten kehrt er zurück an den Ort seiner Herkunft und blickt hinter die Fassaden der Seifenopernlandschaft des Salzkammerguts, das eingekeilt zwischen Tourismuskitsch und Landschaftszerstörung den Schlaf der Gerechten schläft.
Mit dem Idyll will sich der in Irland lebende Schriftsteller allerdings nicht abfinden. Die düstere Aura, die man seinen Romanen gern unterstellt, wurzelt gewiss auch in der nationalsozialistischen Geschichte einer Heimat, die längst abgedankt hat, weil der Begriff brüchig geworden ist.
Ransmayrs großartiger Monolog nimmt Abstand. Er lässt sich nicht beirren vom grellen Tagesgeschehen und verweist es ins Abseits der Flüchtigkeit. Gerade weil er die Perspektive des Außenstehenden einnimmt und den großen Luxus des Alleinseins für sich beansprucht, gelingt ihm der ebenso seltene wie wohltuende Gestus der Demut: „Die menschliche Existenz ist offensichtlich nicht die einzige und größte Aufgabe des Universums. “
Wer in geologischen oder astronomischen Zeitaltern rechnet, wird zwangsläufig an jenen Punkt gelangen, wo die Welt wieder ohne den Menschen existieren wird. Wahrscheinlich ist diese Einsicht nicht dazu angetan, unsere Unruhe zu besänftigen, „aber die Frage ist doch“, wie Ransmayr ausführt, „ob man sich betäuben, trösten, besänftigen will – oder etwas erfahren von der Welt.“
Darum geht es ihm in seiner Literatur und in diesen autobiografischen Bekenntnissen, wo der Dichter und der Mensch zusammenfinden, um das Rauschen im Kopf zu übertönen, das Ransmayr nicht los lässt.
Die Geständnisse eines Touristen stellen ein Nebenprodukt seiner literarischen Arbeit dar und bleiben freilich im Schatten seiner Romane. Aber wenn Ransmayr die Stimme erhebt, lohnt es sich allemal, ihr zu lauschen. Das gilt besonders für diese Prosa.