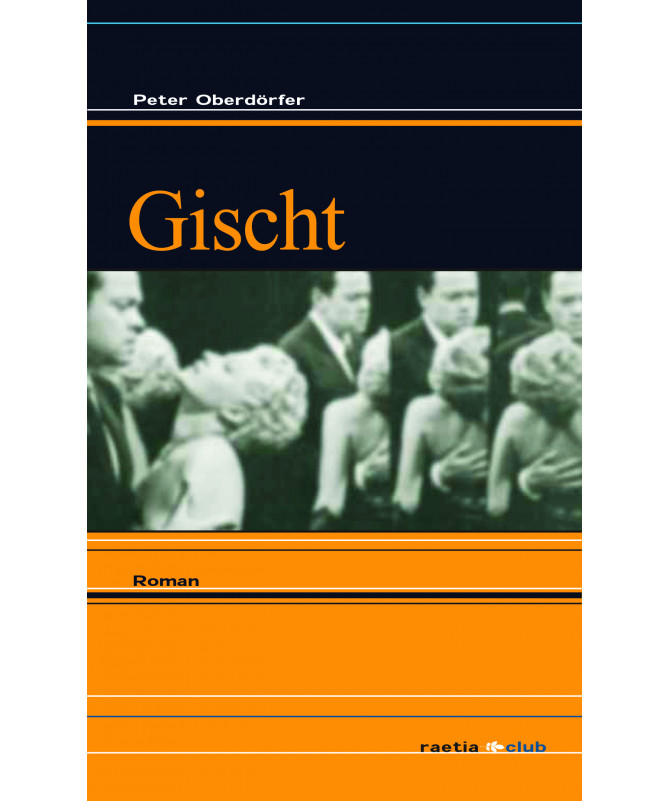Gischt, diesen lautmalerischen Titel wählt Willi für seine Kurzbiografie über den deutschen Regisseur Friedrich Wilhelm Murnau. An diesem Aufsatz über Murnaus Leben hatte Willi zuletzt gesessen, bevor er ohne seine Lebensgefährtin Claudia zu benachrichtigen spurlos verschwand. Gischt lautet auch der Titel des Debütromans des Südtiroler Autors und Theatermachers Peter Oberdörfer.
Von schnellem Erfolg und tiefem Fall, von Ruhm und Scheitern zeugen die Biografien der Stars des jungen Hollywood-Kinos. Ihre exzessiven, rauschhaften, bewegten Leben ziehen Willi in den Bann, ihn, dessen Leben in geordneten Bahnen verläuft, das keine Aufregung oder Spannung mehr birgt. Träge dümpelt er im Meraner Alltag dahin, schon mit sechsundzwanzig wirkt er seltsam gealtert, „stumpf geworden“.
Am Ende, kurz vor seinem tödlichen Sturz in die Tiefe, als er betrunken hoch oben über dem Vinschgau bei einem Annäherungsversuch an eine kühle italienische Schönheit kläglich scheitert, wird Willi die Komik, die Banalität des eigenen Lebens in vollem Ausmaß bewusst werden. Eines Lebens, das noch in derselben Nacht zu Ende gehen wird, eines flüchtigen Lebens voller „Querverweise, Gnadengesuche, Fußnoten, Tabellen, Steigerungen, Senkungen, Kaufkraft, Konjunktur, Rheumatismus, Schutzimpfung“ – „alles lächerlich“.
Anders als das „gischtende“ glamouröse, tragische, exzessive Leben der Stars der Traumfabrik Hollywood schlägt Willis Leben keine hohen Wellen mehr, die Wogen seiner eigenen Studentenzeit damals in Wien haben sich längst geglättet, die bewegte Dreiecksbeziehung zwischen ihm, Claudia und Hans ist an den Klippen des Alltags zerschellt.
Gischt erzählt vor dem Hintergrund von Willis plötzlichem Verschwinden ihre Geschichte einer Menage à trois. Es ist die altbekannte Geschichte einer tiefen Männerfreundschaft, die an der Liebe zu einer schönen Frau zerbricht. Willi und Hans, beste Freunde seit ihrer Kindheit, verlieben sich beide in Claudia, buhlen um ihre Gunst, doch sie will sich nicht für den einen und gegen den anderen entscheiden, sie liebt beide und so leben die drei einen kurzen Sommer lang die Utopie einer Liebe zu dritt: „Verliebtheit, Intimität. Diese ganz besondere Zweisamkeit zwischen Menschen, die man Liebesbeziehung nenne. […] Zu dritt.“
Nach dem Scheitern dieser Utopie kehren Willi und Claudia gemeinsam nach Meran zurück, wo sie nun, acht Jahre später, Wohnung und Leben miteinander teilen, wo der Trott des Alltags und der Gewöhnung in diese ehemals so bewegte Beziehung eingekehrt ist. Hans hat den Kontakt zu ihnen abgebrochen, er lebt mit seiner Frau Irene und seiner Tochter Maria zwar in derselben Stadt, doch begegnen sie sich zufällig auf der Straße, geben sie vor, sich nicht zu kennen.
Erst nach Willis spurlosem Verschwinden, nach Tagen des Wartens ohne jegliches Lebenszeichen wählt Claudia verzweifelt Hansis Nummer und bringt so den Stein der Erinnerung an die gemeinsame Zeit in Wien ins Rollen, an den glücklichen Sommer, als das Experiment einer Beziehung zu dritt zu gelingen schien. Dieser Sommer währte nur kurz, zurück blieb einzig eine dumpfe Traurigkeit, der schale Nachgeschmack des Scheiterns und ein Karton voll persönlicher Dinge aus der gemeinsamen Zeit – Einkaufszettel, leere Zigarettenpackungen, Schnappschüsse, auch ein abgelutschter Pfirsichkern. Dinge, an denen der Geruch dieser gescheiterten Liebe haftet und von denen sich Hansi nicht trennen kann und die er nun, nach Claudias Anruf, wieder aus dem Keller holt.
Der Roman ist aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt, die Blickwinkel der drei Protagonisten wechseln mit der neutralen Beobachtung des Erzählers ab. Oberdörfer gelingt es, die einzelnen Textfragmente stimmig aneinander zu fügen, sodass der Leser nie den Überblick verliert. A-chronologisch werden im Roman die Gegenwart der drei Figuren und ihre persönlichen Erinnerungen an die Vergangenheit in Rückblenden raffiniert ineinander montiert, sodass sich die verschiedenen Erinnerungsfragmente und Momentaufnahmen langsam zu einem Puzzle ihrer turbulenten gemeinsamen Geschichte zusammenfügen.
In dieses Mosaik werden noch vielzählige andere Textfragmente eingepasst: Auszüge aus Hansis Tagebuch – in ihrer Unbeholfenheit und Offenheit gleichzeitig peinlich und anrührend – Postkartengrüße Claudias und Willis, die bereits die Intimität dieser Dreiecksbeziehung anklingen lassen – der Beginn des biografischen Abrisses über das Leben Murnaus und Radionachrichten über das politische Tagesgeschehen. In knappen Strichen wird auf diese Weise der private sowie gesellschaftliche und zeitgeschichtliche Rahmen des Zeitraums von acht Jahren abgesteckt – von 1988, dem Jahr der ersten Begegnung der Männer mit Claudia, bis zu Willis Verschwinden in der Gegenwart des Jahres 1996.
Es sind die späten achtziger Jahre, die Studenten in Wien diskutieren die Postmoderne, sie tragen schwarze Jacketts und Existentialistenpullover, rauchen französische Zigaretten der Marken Gitanes und Gauloises, in der Freizeit lesen sie Foucault und Deleuze, hören John Cage und Stereo MC, verlieben sich zu den Klängen von Sonic Youth und trennen sich zu Rammsteins Das Model. Die Songs der 80er Jahre begleiten die jungen Studenten in die anbrechenden 90er Jahre, noch Jahre später wecken sie Erinnerungen, beschwören diese Zeit der Wirren der Jugend herauf:
Diese etwas kruden Anleihen am stilistischen Repertoire der Popliteratur sollen wohl die authentische Gestaltung des studentischen Milieus der ausgehenden 80er Jahre unterstützen, genauso wie der streckenweise eingesetzte Jugendjargon, die dialektal gefärbten Redewendungen und die hier und da eingebrachten italienischen und dialektalen Slangwörter der Südtiroler Jugendlichen wie etwa „cazzo“ und „dai“. Besonders in den wörtlichen Reden versucht Oberdörfer den Tonfall und die Satzmelodie des Südtiroler Dialektes einzufangen, streckenweise durchaus gelungen, doch auf Leser, die mit dem Dialekt nicht vertraut sind, mögen manche Sätze eher befremdlich wirken als den Eindruck von Authentizität zu vermitteln.
Die verschiedenen Sprachregister, die Oberdörfer im Roman bemüht und die den Leser stilistisch einmal mehr, einmal weniger zu überzeugen vermögen, sind durch die jeweilige Erzählsituation motiviert und stehen dabei ganz im Zeichen einer möglichst naturalistischen Darstellung. Oberdörfers Stil zeichnet sich durch eine klare, schlichte, eine direkte Sprache aus, die gelegentlich auch vor umgangssprachlichen oder derben Ausdrücken nicht zurückschreckt und dem realistischen Erzählgestus des Romans durchaus entspricht. Oberdörfer, der in Meran als Schauspieler und Regisseur im Theater in der Klemme arbeitet, versteht es, eine dramaturgisch stringente Handlungsführung und glaubwürdige Charaktere zu zeichnen, ohne sie zu psychologisieren. In knappen Sätzen, in der Beschreibung weniger Situationen gelingt es ihm, ein Panorama der Liebesbeziehung zwischen Claudia, Willi und Hans zu umreißen, ihr Schwanken zwischen Begehren und Schuldgefühl, zwischen Liebe und Kampf, zwischen Euphorie und Ödnis. In direkter Rede und inneren Monologen lässt er die drei selbst zu Wort kommen, in ihrem Versuch, die widerstreitenden Gefühle in Worte zu fassen, immer wieder im Satz abbrechend, nach Worten, nach einer Privatsprache hinter den leeren Phrasen, dem „Beziehungsgequatsche“ und „Trennungsgesülze“ tastend, um ihren Bedürfnissen Ausdruck zu verleihen.
In der Gegenwart angekommen bleibt jedoch jede der drei Figuren allein, einsame Gefangene des Alltags – Claudia mit ihrer Gewissheit des Verlustes eines geliebten Menschen, Willi mit seinem Gefühl des Scheiterns im Angesicht des Todes und Hans mit einem Karton voller Erinnerungen. Und so blickt der Roman am Ende nochmals melancholisch auf diese drei – sind sie denn wirklich Gescheiterte? Und im Hintergrund singt Neil Young.