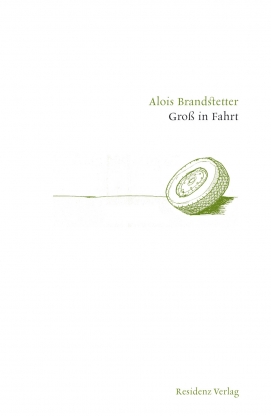Auch in Groß in Fahrt serviert uns Brandstetter das, was spätestens seit „Die Abtei“ seine einzige dichterische Linie geworden ist: etymologische Belehrungen und konservative Gedanken zur Gesellschaft, lose und eigentlich ohne jedes Motiv um eine schwache Erzählidee herum angehäuft. Diesmal ist es der Bruder des Erzaehlers, Franz, welcher früher Prominentenchaffeur gewesen ist, nun aber zum Rotkreuzfahrer umgesattelt hat und am Ende des Romans (man kann es mangels Handlung ja keine Geschichte nennen) vermutlich im Dienst stirbt.
In diesem Zusammenhang räsonniert Brandstetter über alles, was auch nur im weitesten Sinne mit dem Fahren oder Reisen zu tun hat: Sinn und Unsinn vieler Fahrten von Regierungsbeamten, fahrende Schüler des Mittelalters im Vergleich mit der heutigen Interrail-Jugend, die betrügerischen Verschönerungen von Reisekatalogen, Taxifahren und ähnliche Dienstleistungen bis hin zu den Fahrten von Beerdigungsunternehmen (selbstverständlich aufgehängt an Überlegungen zu Charon, dem Fährmann im altgriechischen Hades).
Doch in kaum einem anderen Buch wurde der vom Autor vorgegebene Schreibanlaß so vernachläßigt und wirkt derart an den Haaren herbeigezogen wie in diesem jüngsten Werk Brandstetters: in erster Linie geht es um die üblichen sprachlichen Spitzfindigkeiten, um die Herleitung zahlreicher Wörter aus ihrem heute vergessenen Ursprung; allerdings ist Brandstetter längst die bissige Witzigkeit von „Zu Lasten der Brieftraeger“ verlorengegangen. Er scheint eine Art Missionar der konservativen Lebenseinstellung geworden zu sein, und Missionare sind selten komisch: da wird gejammert über das Übergewicht des Faches Englisch gegenüber Religion oder Griechisch im heutigen Schulunterricht; da wird munter behauptet, daß Wilhelm Raabe mehr wert sei als heutige Autoren – und die Wortspiele bewegen sich auf dem Niveau von „Der Reiniger als Peiniger“ (S. 14).
Und wenn Brandstetter endlich eine Bemerkung entschlüpft, die als Kritik an der Kirche aufgefaßt werden könnte, so distanziert er sich sofort davon, er hätte hier nur die Meinung anderer wiedergegeben. (S. 13)
„‚Wortklauber‘ war einer der noch harmloseren Spitznamen für mich“ (S. 100) gesteht Brandstetter ein, der sich selbst gerne als „Philister“ (S. 16 und S. 79) bezeichnet. Unangenehm an diesem Roman ist nur, daß sich der Philister ständig mit dem Leser anbiedert: mit Sätzen wie „Wir Gesunden können uns in eine solche Sexbesessenheit kaum hineindenken“ (S. 94) oder „Daß es Flugangst überhaupt gibt, kann unsereiner ja gar nicht verstehen“ (S. 50) versucht Brandstetter, sich mit dem Leser auf eine Stufe zu stellen und auf diese Weise wohl den belehrenden Charakter seiner etymologischen Ausfälle zu mindern.
Und auch gegen Rezensionen wie diese hat Brandstetter schon vorgebeugt: „Ich, kein originelles Talent und kein Schriftsteller (dazu bin ich viel zu nüchtern und gesund)“ heißt es auf Seite 79. Da Brandstetter also kein Schriftsteller ist, darf man ihn nicht rezensieren. Vielleicht sollte man ihn auch eher benoten: in Deutscher Sprachgeschichte, Kultur- und Kirchengeschichte und in Betragen einen Einser – aber leider das Thema des Aufsatzes verfehlt.