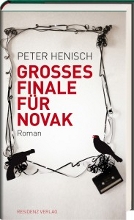Doch der Held des Romans Franz Novak ist weder ein hartgesottener Ermittler noch ein brutaler Verbrecher, die Krankenschwester Manuela taugt nicht zur gefährlichen Femme fatale, nur Herta wird ihrer Rolle als eifer- und rachsüchtige Ehefrau gerecht. Sie geifert und keift, spioniert und intrigiert, was das Zeug hält, doch gerät ihre Figur leider allzu eindimensional.
Gelungener ist dagegen Henischs sympatisches Porträt seiner Hauptfigur. Franz Novak ist ein kreuzbraver Postangestellter in einem kleinen Weiler nahe Wien, er wählt die Partei der Arbeiter und Angestellten, liest die Lokalzeitung, sammelt Briefmarken, und versucht, so gut es geht, mit Herta auszukommen. Ein geplagter Jedermann in einer alten Ehe. Nun ist er fünfundfünzig und außer, dass er zum Amtsleiter befördert wird, hat er keine großen Erwartungen mehr an sein Leben.
Doch dann wird Novak schmerzhaft aus seinem Trott gerissen, seine Gallensteine müssen in einer Notoperation entfernt werden, beinahe wäre es zu spät gewesen, der Bauch hat sich bereits entzündet. Während des langsamen Heilungsprozesses soll er zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Herta gefällt das gar nicht, sie vermisst ihn daheim auf der Couch und am Tisch, und außerdem sind ihr die Krankenschwestern – „Nichts als Ausländerinnen“ – ein Dorn im Auge. Dabei ist Novak von der Operation noch viel zu geschwächt, um sie auch nur wahrzunehmen. Erst, als der laute, vulgäre Kratky zu ihm ins Zimmer verlegt wird und seine Bettruhe empfindlich stört, wendet er sich hilfesuchend an Schwester Manuela. Sie hat ein liebes Lachen, er leistet ihr gern Gesellschaft, wenn sie Nachtdienst hat und er wegen Kratkys Schnarchen nicht schlafen kann. Als selbst Ohropax und Schlaftabletten nichts nützen, bringt sie ihm einen kleinen Kassettenrekorder mit großen Kopfhörern und ein grünes Köfferchen mit Kassetten mit.
„Alles selbst überspielt“, sagt sie, und ob er Opernmusik möge. Sie möge sie sehr. Und dabei berührt sie „mit der rechten Hand die linke Brust“, die „sich sanft unter dem Stoff der Schwesterntracht“ wölbt. „Da kann Novak natürlich nicht einfach nein sagen.“ Dabei wäre er nie auf die Idee gekommen, dass ihm Opernmusik einmal etwas bedeuten könnte, allein die Stimmen der Sänger – „peinlich gekünstelt oder jenseitig pathetisch die männlichen, befremdlich gluckenhaft oder absurd schrill die weiblichen“ – ließen ihn bisher immer rasch den Sender wechseln. „Das kann man doch nicht anhören“, sagte Herta dann, „dieses Geschrei ist ja nicht auszuhalten.“
Auch jetzt empfindet Novak die Opernmusik zunächst im Vergleich zu Kratkys nächtlichem Schnarchen und täglichem Volksmusikprogramm bloß als das kleinere Übel. Doch „manchmal, da wurde er unversehens durch ein Gefühl berührt …, dass es ihm zuweilen, im Dunkeln, die Tränen in die Augen trieb.“ Nachts setzt er sich wieder zu Manuela, fragt schüchtern nach den Arien aus La Traviata und La Bohéme, neugierig geworden, was diese Musik erzählen will, die ihm so nahe geht, auch ohne dass er die Worte versteht. Und während er ihr zuhört, wenn sie begeistert die Handlung nacherzählt, während er so nahe neben ihr sitzt, dass er Herzklopfen bekommt, dass er nachts von ihr träumt, keimt ein neues Gefühl in Franz Novak, wie er es als junger Mann das letzte Mal hatte. Ein Gefühl, dem es zu eng wird im Korsett seiner bisherigen Existenz, das aufbegehrt gegen die Hässlichkeit, die Zumutungen, die „Graue-Socken-Wirklichkeit“ (Nizon) seines Heimatorts Grabern und seiner verkrusteten Ehe.
Nur wenige Wochen, nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen wurde, packt er seine Sachen und geht. Er verlässt Herta und das Dorf und mietet ein billiges Fremdenzimmer in Wien. Er kauft sich einen tragbaren CD-Spieler, Kopfhörer und eine Sammlung CDs und verbringt seine Tage von nun am im Schönbrunner Schlosspark, mit Hoffmanns Erzählungen, dem Fliegenden Holländer, der Zauberflöte und der zärtlichen Erinnerung an Manuela. Währenddessen leitet Herta einen perfiden Rachefeldzug gegen die vermeintliche Widersacherin in die Wege. Ihr Plan geht auf, Manuela verschwindet von der Bildfläche und Novak kommt als gebrochener Mann zu Herta zurück. Doch als diese schon glaubt, er sei endlich wieder zur Vernunft gekommen und alles wieder beim Alten, überschlagen sich die Ereignisse. „Das Finale jedenfalls“, verkündet der Klappentext vorlaut, „ist große Oper: tragisch, furios und grausam dramatisch – und voll leiser Ironie.“