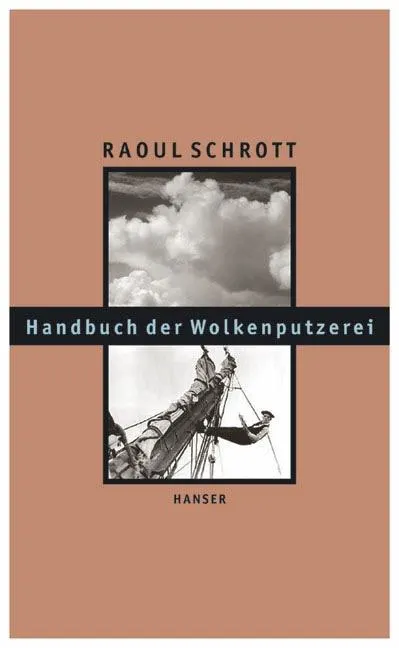So sah sich Delev von Liliencron, so will auch Raoul Schrott sich gerne sehen. Fast leitmotivisch verwendet Schrott das Zitat in seinem Essayband mit dem ungewöhnlichen Titel Handbuch der Wolkenputzerei, stellt sich so 1998 den Studenten bei seiner Antrittsrede in der Sternwarte des Wissenschaftskollegs der ETH Zürich vor.
Klug zeigt er sich in der Folge, launig und verspielt, ein wortgewandter Possenreißer, der den Au-Tor gnadenlos in einen Feld-Narren verwandelt. Als Nächstes räumt er mit dem gesammelten biografischen Unsinn auf, der über ihn verzapft wurde und wird. Er zieht über seinen ungewöhnlichen Vornamen Raoul her, lässt auch den zweiten unbekannten, quasi privaten Namen Ingo nicht gelten und verrät uns ein etwas verunglücktes Anagramm, das er einmal für eine avantgardistische und äußerst erfolglose Zeitschrift für fraktale Literatur verwendet hat: Otto S. Lurch. Über seinen Nachnamen allerdings lässt er andere lästern und ihre unheiligen Assoziationen ziehen, denn eigentlich, sagt er, wenn man’s ihm denn glauben will, heißt er Johannes Bogumil Kratochwil.
In diesem ersten Teil der „Wolkenputzerei“ mit dem Titel „Posen & Possen“ finden sich noch so manche Spitzen und wortgewitzte Lästereien, etwa wenn er den älteren Wiener Semestern an den Kopf wirft, sie seien Meister in der „hohen Kunst des Nörgelns, die nur eine interessante Form des Selbstgesprächs ist.“ Ernst wird Raoul Schrott erst, wenn es um das spezifische Gewicht eines Dichters und seine Existenzbedingungen geht (im zweiten Teil des Bandes mit dem Titel „Eine Erdung der Poesie“).
Danach schrauben sich die Kapitel in luftige Höhen: springen vom „Kompendium der Blitzableitungen“ in den „Luftraum der Wolken“, über „Schall & Rauch“ in „Wolkenkuckucksheime“ bis zur „Leere des Himmels“.
Ein Herzstück stellt dabei der Essay „Fünfeinhalb Gemeinplätze die Übersetzung betreffend“ dar, in dem Raoul Schrott eigene Erfahrungen, Methoden und Überlegungen zu einem konzentrierten Extrakt destilliert.
Aber vor allem und immer wieder dreht sich alles um die Poesie: etwa im „poetischen ABC“, bei der „Kehrseite der poetischen Münze“, natürlich auch in „Fünfeinhalb Gemeinplätze die Poesie betreffend“; Schrott schrieb eine „Verteidigung der Poesie“ und einen Essay „Über das Fortleben der Poesie“. Dabei wird der Verfasser, selbst Poet durch und durch, zum entflammten Advokaten, zum Kanzelredner und Schamanen, dem jedes verbale Mittel Recht ist.
Die „Gesammelten Essays“ (alle in den letzten Jahren für bestimmte Anlässe und Gelegenheiten verfasst und zum Großteil bereits publiziert) lassen einen guten Einblick in Raoul Schrotts Welt zu und sind sicher eine Quelle und Bereicherung für jeden, der sich darauf einlassen will. Die dichten, wortgewaltigen Texte sind allerdings nichts für kühle, abgeklärte Geister, die ein ausgewogenes Für und Wider dem leidenschaftlichen Plädoyer vorziehen.
Für Schrott gilt – im besten Sinn, dass die Wahrheit im Auge des Betrachters liegt.