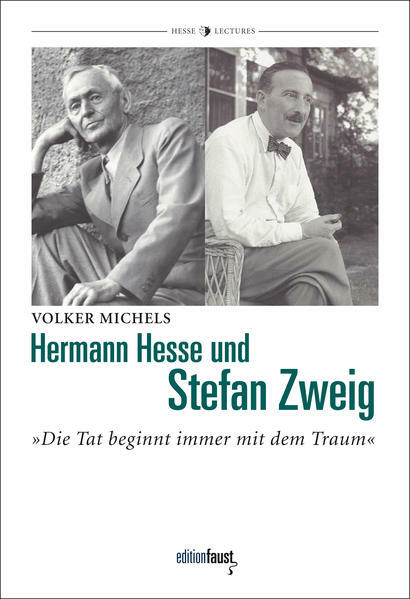Was die beiden dennoch verband, das arbeitet nun der ehemalige Lektor für deutsche Literatur im Suhrkamp/Insel Verlag, Volker Michels, präzise heraus. Der Herausgeber von Editionen zahlreicher im Schatten stehender Autoren schöpft aus dem Vollen, hat er doch die im Verlag lagernden unveröffentlichten Schriften Hesses erschlossen. Da Zweig 30 Jahre lang Autor des Insel Verlags war, fand sich auch über ihn unbearbeitetes Material, das Michels für sein Buch Hermann Hesse und Stefan Zweig. «Die Tat beginnt immer mit dem Traum» sichten konnte. Herausgekommen ist ein kleines, feines Büchlein, das Parallelen im Werk der beiden herausarbeitet und die dafür nötigen biografischen Daten mitliefert.
Im Rückblick ist den beiden Dichtern gemeinsam, dass sie mit manchen ihrer Bücher zwar große Publikumserfolge feiern konnten, von der Germanistik oder gar vom Feuilleton aber stiefmütterlich behandelt werden, was Volker Michels heftig beklagt. Intention des Büchleins scheint auch zu sein, Gründe dafür auszumachen und eine Revision einzuleiten. Zweifellos gibt es innerliterarische Gründe für die Geringschätzung. Michels selbst führt sie darauf zurück, dass Zweig keine „artistischen Experimente“ machte. Er setzte formal ganz auf eine herkömmliche Erzählweise. Selbst Hesse wünscht sich bereits in der Rezension des ersten Erzählungsbands des Freundes „ein keckeres Zugreifen, eine gröbere, kühnere Hand“. Später vermerkt er sogar, dass Zweig „eine Menge Bücher mit schneller Geschicklichkeit und schlechtem Deutsch geschrieben“ habe. Dem hält Michels entgegen, dass Zweig ein Werk geschaffen habe, „dessen Umfang, Eigenart und zukunftsorientiertes Problembewusstsein demjenigen seiner vielgerühmten Kollegen (die Rede ist von Musil oder Thomas Mann, Anm. HK) in nichts nachsteht“. Zweigs „Neigung zur Überdeutlichkeit“, seinen Hang zum Fortissimo, wo „ein Piano genügt hätte“, bestreitet Michels nicht, hält dem aber „die Fülle und Vielfalt dessen“ entgegen, „was dieser Autor wahrzunehmen und darzustellen vermag“.
Anders verhält es sich bei Hesse, dem man – insbesondere was sein Hauptwerk „Das Glasperlenspiel“ anbelangt – nicht vorwerfen kann, „seine Aussagen jedermann begreiflich und nachvollziehbar zu machen“. In den frühen Erzählungen wittert Zweig „etwas von verhaltener Vorsicht, von sentimentaler Rücksicht, die über das Problem, dort wo es heiß, brennend und glühend wird, irgendwie hinwegmusiziert, hinüberlyrisiert“. Doch Hesse war im Gegensatz zu Zweig ein genauer Spracharbeiter. Wenn er „hinüberlyrisiert“, dann mit Absicht. Bei ihm ist es vor allem sein Hang zum Mystizismus, dem man ihm zum Vorwurf machte und mehr denn je macht. Dabei ist gerade die religiöse Komponente der Kern seiner Dichtung.
Das führt geradewegs zu den außerliterarischen Gründen, wenn man so will der Ideologiekritik, die an beiden Autoren vollzogen, aber selten ausgewiesen wird. Galten die beiden doch schon früh als Neoromantiker, die sich gegen die Moderne stemmten und deshalb als rückwärtsgewandt angesehen wurden. Aus anderer Perspektive waren sie der damaligen Avantgarde aber um 100 Jahre voraus, denkt man an die heutige Eroberung der Bestsellerlisten durch den historischen Roman oder gar an weltweite Publikumserfolge wie „Fifty Shades of Grey“, die auf ein postmodernes Bedürfnis nach Romantik schließen lassen. Deshalb verwundert auch nicht die Renaissance der historischen Romane Zweigs, die nach Michels „ganz ohne Zutun der Literaturkritik“ vonstattengeht.
Im Gegensatz zur Avantgarde sahen die beiden ihre Aufgabe als Schriftsteller nicht in erster Linie darin, die Kunst voranzubringen, sondern den Menschen. Sie waren davon überzeugt, dass es ihre moralische Pflicht sei zu vermitteln und einen Enthusiasmus zu erzeugen „für alles Verbindende zwischen den willkürlichen Trennungen der Landesgrenzen, Sprachen, Weltanschauungen und Religionen“, wie Michels konstatiert. Diese Einstellung hat biografische Ursachen. Sie wuchsen in einem prosperierenden, aber müden Europa auf, das in einem Krieg den Ausweg aus der Dekadenz zu erkennen vermeinte. Noch bevor das große Schlachten einsetzte, machten sowohl Zweig als auch Hesse Erfahrungen mit anderen Kulturen. „Distanz von der Heimat verändert das innere Maß“, überschreibt Michels mit einem Zweig-Zitat sein Kapitel über „Indien im Werk von Stefan Zweig“.
Es war der spätere deutsche Außenminister Walther Rathenau, der Zweig dazu animierte, sich „für sein künftiges Werk einen größeren Horizont zu erschließen“ und „erst einmal nach Indien oder Amerika“ zu reisen. Im Herbst 1908 bestieg Zweig ein Schiff nach Bombay. Vier Monate war er unterwegs, sah Gwalior, Agra, Delhi, Varanasi, fuhr weiter nach Burma, kehrte zurück nach Madras, setzte nach Ceylon über, wo er einen Monat verbrachte, bevor er mit der Erkenntnis zurückkehrte, dass in Europa etwas faul sei. Drei Jahre später, im Dezember 1911, traf Hermann Hesse nach seiner viermonatigen Indonesienreise mit der Gewissheit wieder am Bodensee ein, „dass der europäische Geist im Niedergang steht und der Heimkehr zu seinen asiatischen Quellen bedarf“. Er war als Nachfahre von Missionaren schon in seiner Kindheit mit indischer Literatur konfrontiert worden und verehrte Buddha. Von der Reise selbst zeigte er sich zwar enttäuscht, aber der „Indian Spirit“ prägte fortan sein Denken.
Im Werk offenkundig wurde der allerdings erst nach dem großen Krieg. Bei dessen Ausbruch ließen sich Zweig und Hesse noch kurz vom Hurrapatriotismus anstecken. Wenige Wochen danach waren sie aber von jeglicher Kriegsbegeisterung für immer geheilt. Hesse setzte sich schon 1915 öffentlich für eine „übernationale Humanität“ ein, was einen medialen Proteststurm hervorrief. Davon berichtete Zweig seinem pazifistischen Freund Romain Rolland, mit dem er seit 1910 in Verbindung stand. Der Franzose war erfreut darüber, unter den „Feinden“ zwei Gleichgesinnte gefunden zu haben. In Kontakt stand der Literaturnobelpreisträger von 1915 auch mit jenem von 1913, dem ersten asiatischen: Rabindranath Tagore, dessen Essaysammlung „S?dhan? – The Realisation of Life“ unbeachtet von der europäischen Öffentlichkeit 1916 in New York erschien.
Am Ende des Blutbads war es in Europa mit dem Glauben an den humanitären Fortschritt aus dem Geist der Aufklärung ziemlich vorbei. Dankbar wandte man sich alternativen Weltbildern zu. Noch 1918 erschienen die Reden Buddhas. Zweig und Hesse waren fassungslos, dass es von ihnen bis dato keine seriöse Übersetzung gegeben hatte und bewarben das „Menschheitsdokument“. Bald danach plante Tagore eine Vortragsreise durch Europa. Auf dem Weg nach Wien machte er 1921 in Salzburg Station, wo Zweig Gelegenheit bekam, eine halbe Stunde allein mit ihm zu sprechen. In Zweigs Rezension von „S?dhan?“ las man dann: „Der ganze Wahnsinn unserer Betriebsamkeit und Organisation, unserer Kriegswut und unseres Nationalismus wird erst recht klar, wenn wir ihn (anhand dieses Buches, Anm.) von außen aus der Hemisphäre eines anderen Denkens und Fühlens betrachten.“
Genau das versuchten Zweig und Hesse fortan in ihren Werken auf ihre jeweilige Weise. Von Zweig erschien 1922 die (indische) Legende „Die Augen des ewigen Bruders“, Hesse veröffentlichte in diesem Jahr seine (indische) Erzählung „Siddhartha“. Für Volker Michels sind beide Bücher die „Glaubensbekenntnisse“ ihrer Autoren, die das europäische Indienbild stark beeinflusst haben. Im Gegensatz zu Zweigs Legende, die heute weithin vergessen ist, erlebte Hesse „Siddhartha“ in den 1960er-Jahren in der „Hippie-Bewegung“ eine Renaissance. Die in beiden Büchern enthaltene Botschaft, dass „allein die Anstrengung als wertvoll gelten kann, welche die Einigkeit unter den Menschen fördert und das gegenseitige Verständnis zwischen Völkern und Nationen vertieft“, wie Zweig in einem kurzen Selbstporträt von 1936 formulierte, gilt den abgeklärten westlichen Intellektuellen als naiv und antimodern. Michels hingegen ist von der Aktualität der Werke der beiden überzeugt, die sich etwa in Zweigs Zeilen über Hesses „Glasperlenspiel“ ausdrückt: „Nichts ist wichtiger als der Gedanke, wie das Individuelle sich gegenüber der Mechanisierung des Geistes entfalten wird (…) Der unentwegte Terror von außen nötigt uns zu einer Verinnerlichung.“
Als Dichter der Innerlichkeit finden Stefan Zweig und Hermann Hesse heute wieder ein (nach)wachsendes Publikum, obwohl die Rezeption „merkwürdig verstockt, halbherzig und ignorant“ reagiert, wie Michels meint. Seinen Beitrag zur Wiederbelebung der Werke der beiden Schriftsteller hat er mit diesem Büchlein jedenfalls geleistet.