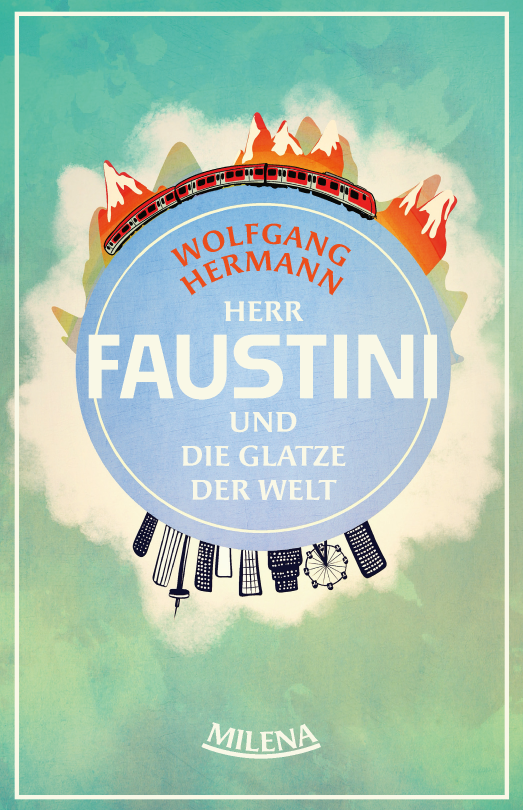Herr Faustini könnte sich als Neffe eines gewissen Herrn Palomar erweisen. Der italienische Autor und Theoretiker der Gruppe Oulipo (L‘Ouvroir de Littérature Potentielle) Italo Calvino hat einen Prototypen geschaffen, der sich liebevoll tollpatschig durch die Welt bewegt und dabei alle zentralen Fragen anfasst und prüft. Da die Gruppe Oulipo als „Werkstatt für potenzielle Literatur“ ferner die Attribute Fantasie, Fragment und Formenstrenge hochhält, fragt man sich, ob Wolfgang Hermann nicht insgeheim dort Mitglied ist. Denn speziell in seiner Faustini-Reihe öffnen sich magische Räume, die mit Andeutungen versehen sind, und die genannten Vorzüge lassen sich leicht unterstellen. Aber wer weiß schon, wo er oder sie überall Mitglied ist?
Die Geschichte beginnt nach einem apokalyptischen Bericht über abgeholzte Wälder in Alaska mit einem Blick in den Himmel. Während Faustini dank dieser Perspektive einen Hauch Unendlichkeit atmet und der Perseidenschauer milde Erhabenheit spendet, so schreckt seine Begleiterin vor diesem Blick ins Universum zurück. Für sie lässt sich das Unfassbare schwer ertragen. Mit einer einzigen Szene entsteht ein Bild von Zugehörigkeit und Einsamkeit. Das Alleinsein ist Faustini gewohnt, aber er weiß auch, es zu meiden. Er findet ein erweitertes Wohnzimmer in der Bücherei, wo ihm mit Michael Endes Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer ein seit langem vertrautes Familienmitglied begegnet und bei ihm bleibt. Doch auch trotz Jim Knopf ist es im stillen Heim eben das Gegenteil: unheimlich. Denn „das Tropfen eines schadhaften Wasserhahns ist das einzige Lebenszeichen weit und breit.“
Die Lektüre lässt allerdings eine Blume erblühen, die immer in Gefahr ist, rasch zu verwelken. Vor allem dann, wenn sich Literatur bedroht sieht durch den Literaturmarkt und das, was man Realismus nennt.
Die Blume ist seit Novalis nicht ohne Gefahr in die literarische Hand zu nehmen. Kann doch das romantische Sehnsuchtsmotiv mittlerweile als verdorrt betrachtet werden. Dieses Risiko ist Hermann nur zu gut bewusst, schließlich hat er einst über Friedrich Hölderlin promoviert. Er ist gewissermaßen mit allen romantischen Wassern gewaschen. Die Fortsetzung der Romantik mit anderen Mitteln im 21. Jahrhundert kann man auch diesem Faustini-Band attestieren, denn die Flughöhe ist durch realistische Windbedingungen angemessen. Hier findet sich kein Ikarus am Radar! Das zeigt sich etwa an einer illuminierenden Szene in der Pfarre zum heiligen Martin in Hörbranz bei Bregenz, wo Faustini zuhause ist. Hier vertieft sich unser sympathischer Anti-Held in eine Verkündigung des Frühbarockmalers Cristofano Allori und erfährt eine Epiphanie. Ist es der Erzengel Gabriel oder doch nur ein altes Männlein mit schlohweißem Haar, das zu ihm spricht? Das Schöne an der Literatur ist, dass das offen bleiben darf. Es ist die Andeutung, die in jedem Kapitel ihren Platz findet, und doch spricht das Buch von einem Ganzen. Angesichts der Erscheinung erinnert sich Faustini an ein Vorgänger-Gemälde aus Florenz: Das Gnadenbild in der Kirche Santissima Annunziata in Florenz. Um 1360 soll es entstanden sein. Der Legende nach soll ein Engel Marias Gesicht zu Ende gemalt haben.
Da steckt allerdings mehr als nur Glaubensseligkeit dahinter. In der Renaissance bricht die Wirklichkeit in die sakrale Kunst ein. Es sind die Landschaften der Apennin-Halbinsel, die den bis dahin meist goldenen Bildhintergrund ablösen. Und es sind Gesichter mit markanten Zügen, wiedererkennbare Physiognomien und weltliche Themen, die in die Gemälde drängen. Hermann ruft angesichts dieser Bildbeispiele die Botschaften der Renaissance in Erinnerung: So entsteht eine Verdoppelung der Aussage: Eine davon lautet salopp formuliert – verkrieche dich nicht in deiner Höhle!
Diesem Appell folgt Faustini. Man kann sich auch in der Höhle der Gegenwart verkriechen, diese ist für Faustini durch eine träge Gleichförmigkeit der Tage und eklatante Ereignislosigkeit entstanden. Man merkt beim Lesen rasch: Es ist eng in dieser Höhle, hier kann sich Faustini nicht bewegen. Es öffnet sich ihm zuerst die Tür zur Vergangenheit. So fängt sein Geist sich an, wieder zu bewegen. Vor mancher Richtung, in welcher er sich bewegt, graut es ihm. Da blitzt etwa Ludwig Uhlands Gedicht Der gute Kamerad auf, das die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg besonders laut gesungen hat, und das der einstige Schuldirektor – man ist fast versucht zu ergänzen „inbrünstig“ – intonierte. Das Lied erfreut sich auch heute noch großer Beliebtheit.
Seine erste Reise überhaupt – ein Roadmovie ins kommunistische Ungarn – holt den Sinnierenden ein. Damals verschaute er sich in die Mutter seines Kompagnons Klaus, während dieser Faustinis Schwester auf einem sozialistischen Acker liebte und beim Lustschrei die immer griffbereiten Gewehre der Soldaten zum Erklingen brachte. Die Maschinengewehrsalven vertrieben die Möchtegern-Hippies aus ihrem Paradies. Das waren die Abenteuer der Jugend, die mit einem Verweis auf die britische Rockband Led Zeppelin zeitlich markiert ist. Wohingegen die Schwester heute an der Seite ihres als Schönheitschirurg arbeitenden Mannes das Leben im goldenen Käfig verbringt – immerhin durch Poolpartys mit Reichen und mit Sicht auf den Laggo Maggiore getröstet.
Es ist die Skizze, die jedes Kapitel in Herr Faustini und die Glatze der Welt ausmacht. Faustini trifft im Bahnhofscafé Martin, der ebenfalls nicht zu den ganz Erfolgreichen zu zählen ist. Seine Markenzeichen sind eine Glatze und ein seltener Begleiter, nämlich das Eichhörnchen Luther. Über Martin Luther ließe sich viel erzählen, aber vor allem dient der Verweis auch als Zeichen des Aufbruchs und einer Reformation, in diesem Fall einer sehr persönlichen. Martin trauert Evelyn nach und Faustini trauert einem vergangenen Leben nach, das zwar voller verpassten Möglichkeiten ist, aber eben auch die muss man erst einmal gehabt haben. Die beiden machen sich auf nach Wien und reisen in ihre Vergangenheit, um in einer neuen Zukunft anzukommen.
„Kommt es dir auch so vor, sagte Martin, als würde die Welt draußen vor dem Fenster vor uns fliehen?“ (S. 49). So endet Kapitel 9 und damit ist die buchstäbliche Reise im Zug genauso angesprochen wie die metaphorische durch die eigene Vergangenheit.
Faustinis Erlebnisse sind mit vielsagenden Details angereichert. So erinnert er sich an seine Studentenzeit in Wien, an die literarischen Vorbilder wie Doderer und später anlässlich der Prag-Reminiszenz naturgemäß an Kafka. Das Märchenhafte hüllt den Schrecken des Zusammenlebens ein, selbst der sadistische Lehrer wird so noch gebannt und seiner Gewalt beraubt. Das Verstörende am „System“ ist eingepackt in die eine oder andere ironische Miniatur. Wenn Faustini etwa bei seiner Prag-Reise erkennen muss, dass der beständige Marsch zur Zimmerbuchung beim Bahnhof leicht durch eine Bestechung hätte abgewandt werden können. So aber muss er täglich ein neues Zimmer buchen, dass er bloß für eine Nacht beziehen darf.
Der Gegensatz zwischen dem Land und der großen Stadt manifestiert sich in diesem Befund: „Für Dinge, die aus der Zeit gefallen waren, war in Hörbranz kein Raum. Erinnerungslos erschien ihm das Dorf, glatt gestrichen vom Wind des Vergessens, während hier im Schimmer so mancher düsteren Seitengasse die Pflanze der Vergangenheit sich noch blühend behauptete.“ (S. 62). Es ist gerade diese Vergangenheit, die sich beim Akt des Erinnerns neu zusammensetzt und damit auch die Gegenwart nährt. Denn im finalen Wandel begegnet Faustini einer mütterlich anmutenden Frau, die er einst in Klaus‘ Mutter zu erkennen meinte. Diesmal aber gelingt Faustini die Begegnung und verharrt nicht nur in gut geübter Projektion.
Die kleinen Spannungsbögen sind mit einem größeren verbunden. Immer wieder geht es um das Reisen in den Faustini-Büchern. Der Aufbruch ist nötig, um einen verborgenen Teil der Persönlichkeit zu entdecken oder etwas Verhülltes der Vergangenheit offen zu legen. Das Fragmentarische als dramaturgisches Mittel, um eine romantische Aura zu erzeugen, gelingt Hermann immer wieder neu. Manche Verspieltheit artet in Blödelei aus, sie ist allerdings nie so geschwätzig, dass sie die Hauptfigur beschädigt. Die dezenten Charakterisierungen schaffen eine ausdrucksstarke Typologie. Etwa wenn ein Wiener Ober so porträtiert wird: „Hagebuttentee, bitte sehr, sagte der Kellner, und er sagte es so, dass man spürte, er war froh, dass er es nicht oft am Tag sagen musste.“
In seinen Texten hat Wolfgang Hermann seinen Eltern schon mehrmals literarisch aufgelauert. Auch diesmal folgt eine minimale Referenz auf die Über-Mutter und den Unter-Vater. Doch das Psychologische begehrt nicht auf, sondern weiß um die eigene Rolle in diesem konzentrierten Roman, der dafür plädiert, in Bewegung zu bleiben.
Denn ein Leben im Stillstand ist einfach so kahl wie mancher Kopf.
Alexander Peer, geb. 1971 in Salzburg, Studien in Germanistik, Philosophie und Publizistik. Peer lebt heute als freier Autor in Wien. Zahlreiche Beiträge zu Literatur, Philosophie und Architektur. Bücher (Auswahl): Die Kunst des Überzeugens (Goldegg, Jänner 2025) 111 Orte im Pinzgau, die man gesehen haben muss (Emons Verlag, April 2022), Gin zu Ende, achtzehn Uhr, Der Klang der stummen Verhältnisse, Bis dass der Tod uns meidet sowie Land unter ihnen (alle Limbus Verlag) sowie Ostseeatem (Wieser Verlag 2008). www.peerfact.at