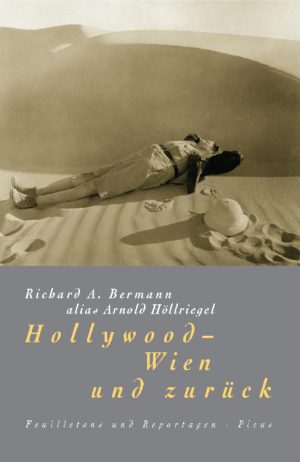Richard A. Bermann ist ein Genie des ersten Satzes. „Wieder einmal Weihnachtsbesuch in der alten Stadt. Aber nein, sie ist nicht mehr die alte.“
Oder: „Manchmal hat man das kuriose Gefühl: jetzt erlebe ich meine Memoiren.“
Oder: „Die Studenten der tschechischen Technischen Hochschule in Prag streiken ein bisschen.“ Sofort fragt man, warum streiken sie „ein bisschen“, und schon hat einen Bermann in sein Feuilleton hineingelockt.
Das Schaffen von Richard A. Bermann alias Arnold Höllriegel, einem „der führenden Journalisten Deutschlands“, wie Hermann Broch schrieb, ist vielseitig, es reicht von der Reportage bis zum Reisebericht, vom Künstlerportrait zur Ausstellungsbesprechung. Bermann verfaßte Theater-, Film- und Literaturkritiken ebenso wie tagespolitische Kommentare oder historische Abhandlungen. Sein erklärtes Ziel war ein „künstlerischer Journalismus“, der zugleich stets von politischem Interesse und analytischem Blick geleitet wurde.
Seine Lebenserinnerungen „Die Fahrt auf dem Katarakt“ wurden 1998 als Wiederentdeckung gefeiert. Der nun vorliegende Band gibt einen schönen Einblick in die journalistischen Arbeiten Bermanns, chronologisch geordnet von 1911 bis zum Jahr 1938 (ein Jahr später starb Bermann im Exil in den USA) lernen wir den Autor als Zeitbeobachter kennen, dem gelingt, was zum schwierigsten in diesem Genre zählt, nämlich die eigene, gerade im Fall von Bermann sehr turbulente Zeit, auf den Punkt zu bringen, sofort zu erkennen, was wichtig werden wird, auch wenn es gerade erst in den Kinderschuhen steckt. Die Liste jener, die er „entdeckt“ oder früh gefördert hat, ist lang, sie reicht von Joseph Roth bis zu Franz Werfel. Bermann hatte ein gutes Gespür für junge Strömungen und die nötige Offenheit dafür, sie zu erfassen, zu beschreiben und als Vermittler tätig zu werden.
In Wien und Prag aufgewachsen und später in Berlin tätig, brachte er die verschiedenen Literaturen miteinander in Verbindung. Bermann wird stets als „Genie der Freundschaft“ beschrieben, als jemand, der mit vielen Künstlern in losem Kontakt oder sogar in freundschaftlichem Austausch stand – mit Arthur Schnitzler, Richard Beer-Hoffmann oder Leo Perutz, mit dem er dieselbe Schule besucht hatte, um nur einige wenige zu nennen. Bei seinen Aufenthalten in Hollywood lernte er 1927 Charly Chaplin kennen, den er wohl am meisten von allen Filmschaffenden verehrte, was sich in zahlreichen Artikeln niederschlug. Über dessen Film „City Lights“ schrieb er sogar ein kleines Buch.
In einem der schönsten Texte beschreibt Bermann ein Treffen mit dem alten Peter Altenberg am Semmering, so wie sich Altenberg vielleicht selbst beschrieben hätte. In einer Skizze, die nicht mit herzlicher Ironie spart. P. A. sagt: „Einen Mantel trage ich nie – absolut nie.“ Als die beiden spazieren gehen, zieht er „ganz harmlos“ seinen großkarierten Ulster an. Bermann versteht das, und erklärt es uns: „Wenn er spricht (gemeint ist P. A.), wie wenn er schreibt, meint er immer das, wonach er sich sehnt, nicht das, was ist.“ Bermanns Porträts von Gustav Klimt, Alexander Moissi, Stefan George oder Victor Adler erschließen nicht nur die Person, sondern präzise auch das Umfeld, die Zeit und die Freundeskreise.
Mit Einbruch des ersten Weltkrieges findet sich der „sozialpolitische Schriftsteller“ (Hermann Broch über Bermann) mehr und mehr ermutigt oder, je nachdem, durch seinen Pazifismus gezwungen, deutlicher Stellung zu beziehen. Die Kriegszeit verbringt er als „pazifistischer Kriegsberichterstatter“ (Broch) der liberalen Wiener Zeitung „Die Zeit“. Das Ende des Krieges erlebt er in Wien. 1919 beschreibt er retrospektiv, wie am Anfang des Krieges die Kriegsbegeisterung um sich gegriffen hat, wie die Straßen voll waren von Kindern in „herzigen kleinen Uniformen“. Später tauchten die Kinder in wirklichen Uniformen auf der wirklichen Front wieder auf: „Das Spiel war nicht mehr Soldaten, sondern Kanonenfutter“. Dann schlägt Bermann einen weiteren Haken zur unmittelbaren Gegenwart. Waren es früher Kinder der Reichen, die stolz von den Eltern als kleine Soldaten verkleidet wurden, so sind es jetzt Proletarierkinder, „die des Kaisers abgelegte Röcke abtragen müssen“: „Sie sind nicht besonders stolz auf den Vorzug, sie salutieren nicht, sie spielen nicht Soldaten, sie wissen überhaupt nicht, was das heißt: spielen.“ Thematisch hängt Bermann seine kritischen Beobachtungen gerne an Alltagsszenen auf. Er beschreibt, wie die Kriegsbegeisterung in so alltägliche Bereiche wie Zivilkleidung hineinwirkt. In diesem populärkulturellen Interesse ist Bermann wie einer aus unserer Zeit.
Spannend sind auch seine Reisebeschreibungen. In „Suchen wir Zarzura!“ kommt der ungarische Graf Almásy, den wir aus dem Film „Der englische Patient“ kennen, zu Bermann, und die beiden machen abenteuerliche Pläne für eine Wüstenexpedition. Es gilt, eine unentdeckte Oase, die in zahlreichen Erzählungen durch die Köpfe geistert, endlich real aufzustöbern. Für Bermann ist diese Expedition aber mehr als bloß ein Abenteuer, sie ist zugleich Flucht, wie er seinem Tagebuch anvertraut: „Ich trete diese wildeste, abenteuerlichste, gefährlichste meiner vielen Reisen an und weiß, dass es einfach eine Flucht ist, eine Flucht vor den unerträglich gewordenen politischen Verhältnissen in Mitteleuropa, vor den Nachrichten, vor den Ereignissen, vor der beruflichen Situation eines deutschen Schriftstellers, hinter dem die deutsche geistige Welt zusammenkracht wie ein morsches Gebäude.“
In besagter libyscher Wüste erreicht ihn gerade zu seinem 50. Geburtstag telegraphisch die Kündigung des „Berliner Tagblattes“. Ab 1933 kehrt er nach Wien zurück und schreibt nun nur mehr für österreichische Zeitungen. Und nach dem Einmarsch der Hitler-Truppen arbeitet er in New York als „Journalist ohne Zeitung“, wie er selbstironisch anmerkt.
Wie geht der erste Satz von „Suchen wir Zarzura!“? „Zu mir kommen sie alle, die Sehnsuchtskranken, die Wanderlustigen, die Reisenden.“ Will man da nicht sofort mehr wissen?