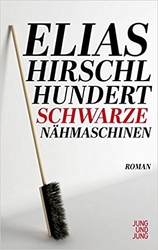Grundlage und zentrales Merkmal dieser Konfrontation ist die tägliche Auseinandersetzung mit dem in der WG omnipräsenten radikal Anderen der „Klientinnen“ und „Klienten“, mit ihrem sich über die Grenzen der Rationalität ganz selbstverständlich hinwegsetzenden Denken, das sich wiederum in gänzlich nonkonformes Sprechen und Tun übersetzt. Die dieser Auseinandersetzung – die auch ein beide Seiten betreffendes Ausgesetztsein mitumfasst – eingeschriebene Gefahr wird von Berni, einem der hartgesottenen Betreuenden in der WG, gleich zu Beginn des Buches – als Warnung, die fortan nicht nur den Zivi, sondern auch das Lesen begleitet – ausgesprochen: „Da kann man noch so oft behaupten, dass psychische Krankheiten nicht ansteckend sind – es stimmt einfach nicht.“ (14)
Von dieser Möglichkeit der Übertragung, der Identifikation, der Appropriation des psychisch Devianten und/oder Anderen ausgehend ist Hirschls Roman, im Unterschied etwa zur Antipsychiatriebewegung der 60er und 70er Jahre, weniger an der angeblichen oder tatsächlichen Ununterscheidbarkeit von Wahnsinn und Normalität interessiert als vielmehr an den Ursprüngen psychischer Erkrankungen. Der Zivi erfährt aus den Krankenakten die Lebensgeschichten der WG-Bewohner und -Bewohnerinnen und versucht, in fiktionalen Ätiologieerzählungen biographische Momente nachzuvollziehen, die den Ausbruch der jeweiligen Erkrankung bewirkt oder zumindest entscheidend dazu beigetragen haben. Diese aus Sicht des jeweiligen WG-Bewohners, der jeweiligen WG-Bewohnerin erzählten Biographiemomente, die als scheinbar retardierende Elemente in den Hauptplot – Arbeit und Leben des Zivis – montiert sind, zählen zu den intensivsten, eindrücklichsten Passagen des Romans. Die darin spürbar werdende Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit verdunkelt insbesondere die (scheinbare) Komik der – sehr überzeugend beschriebenen – Verhaltensweisen der WG-Bewohner und -Bewohnerinnen. Hinter geradezu anarchistisch anmutenden, grotesk-skurrilen Regelverstößen steckt, so scheint es, hohe individuelle Tragik.
Hirschl belässt es in „Hundert schwarze Nähmaschinen“ aber nicht bei diesem auf eindeutigen Kausalitäten beruhenden Erklärungsmodell, das ja letztlich auch impliziert, dass es einen Grund – wenn nicht gar einen Sinn – hinter psychischen Erkrankungen gibt und vielleicht sogar Heilung möglich ist. So lässt er den Sozialbetreuer Berni, der die Aufzeichnungen des Zivis liest und aufgrund seiner langjährigen Erfahrungen mit den Kranken eine gewisse (durch allerlei wirre alkoholbedingte Aussagen allerdings etwas in Frage gestellte) Autorität in Anspruch nehmen kann, eine gänzlich gegenteilige Position einnehmen: „Du lässt es so aussehen, als ob da Logik hinter den Krankheiten stecken würde. Dabei sind es einfach nur Krankheiten.“ (228) Und weiter: „Du kannst genauso gut ein Psychopath werden, wenn du eine sehr schöne Kindheit hattest.“ (229) Für Berni ist das Sichheranschreiben des Zivis an die psychisch Kranken der Versuch, das unabänderlich Irrationale zu rationalisieren, das rein Willkürliche in einen Sinnzusammenhang zu pressen.
Der Zivi ist nun im Hinblick auf die den Diskurshorizont des Romans bestimmenden Psychotheorien und -dynamiken keineswegs nur Chronist, sondern vielmehr Protagonist und (literarischer) Proband in einem. Die gesamte Ambivalenz von Kausalität und Zufälligkeit, von Begründung und Ergründung psychischer Erkrankungen verdichtet sich in ihm. Familiäre Herkunft (der Vater des Zivis ist Psychologe) wie die durch dauernde Psychospielchen zerbrechende Beziehung des Zivis bilden den Rahmen, der Zivildienst selbst das Zentrum der (im doppelten Sinne) Psychomotivik. Die Klientenerzählungen des Zivis sind als Spiegelbilder ihres fiktiven Autors lesbar, aus ihrer wird seine Geschichte und aus seiner Geschichte wiederum, auf einer anderen Erzählebene, der Roman. Dabei funktioniert „Hundert schwarze Nähmaschinen“ als literarische Versuchsanordnung – was passiert mit einem intellektuell ambitionierten und sensiblen jungen Mann in einer psychosoziale Normsetzungen permanent unterlaufenden Umgebung – ebenso wie als Spekulation über das Wesen nicht nur psychischer Krankheiten, sondern des Psychischen selbst. Ohne schlichte Lösungsansätze zu bieten, verweist jenes fragile Netz aus Verweisen und Brüchen, Andeutungen und Zurücknahmen, das Elias Hirschls großartigen Roman ausmacht, dabei letztlich auch auf das in literarischen Verfahrensweisen liegende Potential, Erkenntnis als widersprüchlichen, unabschließbaren und dennoch oder gerade deswegen lohnenden Prozess zu zeigen und verstehbar zu machen.