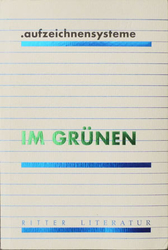„sonne ersticht / nebel // nebel erstickt / sonne“. Kurze Zweizeiler sind das formale Grundgerüst des unpaginierten, inhaltlich vielfältigen Buches, gewidmet „haus und straße“. Je zwei Verse werden zu einer Strophe, mindestens zwei bis maximal acht Strophen auf einer Seite zu einem Gedicht gefasst.
Aphoristisch anmutende und kursiv geschriebene Zweizeiler befinden sich zwischen den gedichtartigen „Gebilden“, wie die Texte auch vom Verlag genannt werden. Nach genau fünf Seiten Text durchbricht jeweils ein Sinnsprüchen verwandter Zweizeiler die Anordnung, wie etwa dieser:
„es stockt. / das ist die stockung.“
Hier werden auch Satzzeichen verwendet, die ansonsten ausgespart sind. Manche dieser kleinen „Weisheiten“ nehmen sich selbst nicht ernst, manche sind gelungener als andere, aber derartige Aphorismen sind an sich eine schwierige und die Geister scheidende Angelegenheit. IM GRÜNEN dienen sie mehr einem Aufbrechen der Struktur und einem Augenzwinkern als einem bildungsbügerInnenhaften Anspruch.
Die systematische Anordnung, die genaue Bauart fassoniert in ihrer strengen Form die Texte. Vier Kapitel bilden hierzu die Basis, sie sind mit DATUM, ZEIT, WASSER und LUFT – so wie auch das Buch selbst – in Großbuchstaben betitelt, was der sonst konsequenten Kleinschreibung gegenübersteht. Allgemein geht es um Natureindrücke, Gewohntes, um das Empfinden von Bekanntem und dem darin gefundenen Unbekannten.
Auffällig ist auch, dass die Gedichte meist nicht abgeschlossen sind, sondern nach hinten hin ausgefranst, vom nächsten Text nicht scharf zu trennen, was in der forttreibenden Stetigkeit etwas sanft Gebetsartiges, etwas beinah Litaneiisierendes hat.
Wie kommt das Mantrahafte, der entwickelte Duktus, der, wie es auf der Buchrückseite heißt, „unaufgeregte Ton“ zustande, erinnernd an „Traditionen fernöstlicher Dichtung“? Einerseits durch die größtmögliche Aussparung von Personalpronomina, andererseits durch viele grammatikalische Leerstellen auf der Ebene der Syntax, wobei die Valenzgrammatik zwar außen vor gelassen wird, aber im Sinne einer „korrekten“ Grammatik keine „groben“ Regelverstöße angestrebt werden. Im Verlagstext wird dies „Kurzschrift“ genannt. Ja es ergibt sich etwas, das wie nebenher ans Ohr dringt, wie Sprachfetzen, zum Beispiel in der U-Bahn oder im Zug – nur um ein vielfaches pointierter. Der Inhalt scheint dabei weniger zentral. Doch auch dies ist nicht Programm und verkehrt sich ab und zu ins Gegenteil: „einwandfreier tag / gut ausgeleuchtet // schnellt die pupille / zum himmel // ein schlag ins gesicht / hart und kurz // tadellos trefflich / ferner gelungen“. Dies trifft auch auf die Texte umgemünzt zu.
Nur einmal wird das Programm, das sprachliche Stilprinzip durchbrochen – und dies sogar davor angekündigt: „wird von dir alles einer verwertung zugeführt?“ In der Thematisierung der literarischen Verwertung ändert sich die Vorgehensweise, die eigene Programmatik wird an einer Brechung derselben vorgeführt, an einem Abweichen davon – um dann wieder in das Schema wie zuvor zurückzufinden. Diese Abweichung oder Verwertung „von allem“, findet sich so dargestellt: „holsatia, edda / silberner stern // neptun, hanse / navio, isar // die abfuhr / in auszügen // suanca, charly / nautic, ella // wacker, apollon / monte wymper // in der reihenfolge / ihres erscheinenes […]“
Das auf der Buchrückseite erläuterte Verfahren erschließt sich auch ohne dessen Ankündigung oder unmittelbare Verweise im Text. Dass hier etwas ausgeschnitten ist/wurde, schiefgerückt oder bereinigt, je nachdem, wie man es mit der Sprache hält, wird nach nur wenigen Zweizeilern offenbar. Und im Hintergrund hört man den Text dabei sarkastisch, zumindest ein bisschen spöttelnd hüsteln, um dieses ach so ernste rituelle Sprechen liebevoll zu stören.