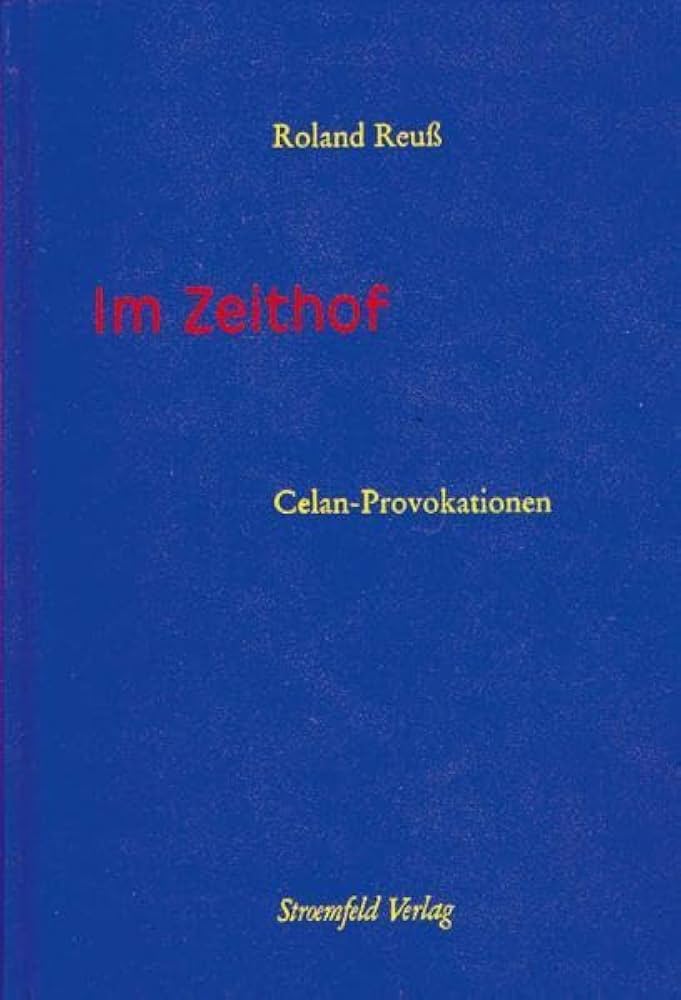In vier Anläufen nähert sich Reuß der Lyrik Celans: durch die Lektüre des zwei Jahre vor seinem Tod geschriebenen Gedichts „Einkanter: Rembrandt“, des posthum 1971 veröffentlichten Gedichts „Schwimmhäute zwischen den Worten“, des Einleitungsgedichts zu „Atemwende“ „Du darfst mich getrost / mit Schnee bewirten“ und durch eine abschließende Reflexion, die den Ort von Celans Dichtungsbegriff zu erkunden sucht. Daß nur Genauigkeit den Dialog zwischen Autor und Leser begründen kann und daß nur eine Lektüre, die sich durch hartnäckiges Fragen beunruhigen läßt, provozieren kann, weiß Reuß, und er führt dies in seiner in allen drei Interpretationen angewandten Methode einer Zeile-für-Zeile-Lesung vor. Dort, in und zwischen den Worten, ihrem Klang und ihrer Aura Hinweise für ein Sagen am Rande des Schweigens zu finden, dafür ist Reuß der richtige und begeisterte Leser, dem die Arbeit mit dem Gedicht das Vergnügen ist. Man kann nur staunen, wie der Interpret immer wieder neuen Verästelungen und Anspielungen nachgeht (auch wenn sie sich bisweilen als Holzwege entpuppen), dabei seine eigenen Worte wägt, zurücknimmt und in Frage stellt; wie er aber auch eine einmal gewonnene Lesart nicht so leicht aufgibt (etwa die Physiologie der Schwimmhäute auch dann noch dem Leser mitteilt, wenn sie sich für das Verständnis des Textes bereits als marginal erwiesen hat) und die Prämissen seiner Interpretation dem Leser wenig Spielraum lassen („Das Wort ‚EINKANTER‘ scheint sich zunächst aus der Umgangssprache zu erklären“).
Schreiben heißt sich selber lesen, so einmal Max Frischs Tagebücher. Es ließe sich nicht nur für Celan sagen, dessen Lyrik monologisch und dialogisch zugleich war, sondern vor allem auch für den Kenner seines Werks, Roland Reuß, der in einen Dialog mit den Wortdestillaten des Dichters eintreten (sie jedoch keineswegs ‚dechiffrieren‘) will. Das ist spannungsreich, erhellend, ein intellektuelles Vergnügen. Dennoch: ein Unbehagen bleibt angesichts so viel philologischer Akribie (189 Fußnoten für knapp 40 Seiten Text), das auch das Vorwort mit seinen Invektiven zum „antiintellektuellen Impuls“ mancher Interpretationen nicht entkräften kann. Andererseits: wieso nicht auf Wortkargheit mit Wortreichtum reagieren, zumal wenn es in solch schönem altmeisterlichen Ton geschieht.
Vielleicht ist ja alles Sagen wie alles Schweigen (und es gibt, wie Robert Walser, ganz außerordentlich wortreiche Schweiger) nur der letzte Versuch eines tief durch Wissen verunsicherten Individuums, Halt zu finden; eines Individuums, dem neben der Welt auch das Wort abhandengekommen ist. Was darüberhinaus an blitzender Erkenntnis zu retten war: man lese es und staune.