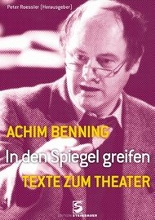Benning, so Roessler, sei „nicht theatrozentrisch“ (S. 6), und das zeigen auch seine im Band versammelten „Anlasstexte“. Es geht immer um das Theater und seine Akteurinnen und Akteure, doch es geht immer auch um die Welt und ihre Verfasstheit jenseits des Bühnenrandes. Der Titel des Buches entstammt übrigens einer unpublizierten Notatensammlung Bennings zum Thema Spiegel und verweist auf ein Reflexionsniveau, dem pure Proklamationen und programmatische Ankündigungen wenig bedeuten, die Theaterpraxis hingegen viel. Das war wohl einer von Bennings fatalen „Fehlern“ in seiner Burgtheaterzeit: Er hat auf die Schmutzkampagnen, die von der Kronen Zeitung bis zur bürgerlichen Presse gegen seine Direktion organisiert wurden, mit Argumenten zu reagieren versucht und mit seiner Arbeit. Das hat ihm nicht geholfen, da die erbitterten und zum Teil unglaublich untergriffigen Kampagnen alle im Zeichen des Kalten Krieges standen und ihm unterstellten, eine DDR- also kommunistische Infiltration des heimischen Nationaltheaters zu betreiben. Das entsprach dem Geist des Kulturkampfs der 1970er/80er Jahre, als das bürgerliche Lager der kulturellen Öffnung unter Kreisky und den eigenen wiederholten Wahlniederlagen mit immer aggressiveren Tönen entgegenzuarbeiten versuchte.
Darin sieht Peter Roessler im übrigen – und das ist eine plausible Erklärung – auch einen der Gründe für die radikale Amnesie in der Causa Benning: Es gab „Personen des Theater- und Kulturbetriebs, denen am Vergessen gelegen war“ (S. 42), die, als die Kulturkampftöne nicht mehr angesagt waren, mit der eigenen Kulturkampfvergangenheit nicht mehr konfrontiert sein wollten. Den Start der Ära Peymann als tabula rasa zu interpretieren war dafür von Vorteil. Das bedingte freilich auch, die konsequente und zugleich sorgsame Arbeit an einer Revision des Theaterkanons von Benning und seinem Team ebenso wie die Modernisierung und Demokratisierung der internen Strukturen am Theater totzuschweigen. Uns so geschah es auch. Peter Roessler übertitelt das entsprechende Kapitel seines Aufsatzes sehr fein mit „Erinnerung“, so wie er generell auf radikale Töne in der Darstellung der damaligen Verunglimpfer ebenso verzichtet wie im Urteil über Claus Peymann als Mitbetreiber und Profiteur der „Ausradierung“ der Ära Benning.
Was der vorliegende Band mit den Texten Achim Bennings auch zeigt, ist sein völlig anderer Umgang mit Selbstpräsentation. In keinem der Texte stilisiert sich hier ein großer Direktor, und in keinem der Texte wird kokettierend das mediale Klavier bedient. Auch das war wohl ein „Fehler“ Bennings. Neben wertschätzenden Hommagen an SchauspielerInnen, RegisseurInnen und AutorInnen enthält der Band auch Texte von Pressekonferenzen und anlassbezogene Stellungnahmen, die eine Ahnung von der Brutalität der Attacken und Verleumdungen vermitteln.
Eine der wenigen JournalistInnen, die damals konsequent die Dummheit und Verbohrtheit der Kampagnenführer aufzuzeigen versuchte, war Sigrid Löffler. „1778. Lenz bei Oberlin“, stand im Programmheft einer Büchner-Inszenierung. Viktor Reimann übersetzte diesen unschuldigen Satz für die Kronen Zeitungs-Leser so: „Im Programm steht, daß Lenz 1778 nach Ostberlin (!) kam. Der DDR-Chargon ist tief in die Sprachweise eingedrungen. Im Goethe-Jahr hätte das Stück nicht unbedingt gespielt werden müssen. Ein Tragödienvorschlag: Die Leiden des Burgtheaters unter Benning.“ (S. 21) Es ist das Verdienst Peter Roesslers, dass er mit diesem Band den Diskurs über die „Freuden“ und Verdienste dieser Ära eröffnet.