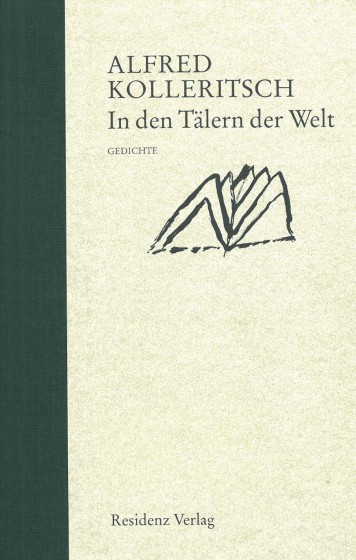In den Tälern der Welt läßt schon im Titel die Melancholie anklingen. „Die Täler“, das ist das Enge, das Begrenzte, das Schattige, der Gegensatz zum Erhabenen; das Irdische schlechthin.
„Über uns hinaus“ eröffnet den Gedichtband: Die Erinnerung an das Vergangene macht das Mögliche sichtbar.
!Wir sind dagesessen. Die alte Eiche / hielt uns zusammen, / sie schickte Blätter, / Silben des Gesprächs, / den Raum.“ (S. 5) Die erste Strophe evoziert das Bild einer Geborgenheit, die vom Zusammensitzen mit anderen genauso ausgeht wie vom Raum, den das Blätterdach des Baumes bildet.
Die dritte Strophe wechselt vom Plural, dem Gruppen-Wir zum paarbildenden Ich und Du: „In den Feldsträuchern erkannte ich dich,/neben mir warst du,/ wir spürten das Licht auf, den Zuruf, / im Wind, er zeigte uns die Grenze, / kein hohes Wort braucht sie, / sie läuft tief in die Schatten, / sie werfen uns mit, / wenn wir sie werfen, / uns verwerfend.“ Die vierte Strophe wechselt das Tempus, von der Vergangenheit in die Gegenwart: „Der Schrecken ist, / daß wir es erhalten, dazwischen / sind wir, Mündung, / die Kunde gibt, Wange an Wange: / Daß keiner entbehren muß.“ Diese Strophe wirkt vorerst vielleicht etwas dunkel; welches „es“ werden wir erhalten? Strophe drei stellt den Bezug her: das Licht ist das, was wir alle erhalten werden, und dieses kann sowohl mit letzter Erkenntnis, mit Tod assoziiert werden. Das Gedicht berichtet von Grenzen, die tief in die Schatten hineinreichen; über den Tod als die Grenze unserer Welt, unserer Möglichkeitshorizonte, als das, was „über uns hinaus“ weist. Und Schatten als ein Bild, das sowohl verborgen Unbewußtes wie auch die flüchtige Spur des Lebendigen miteinschließt.
Der weitere Verlauf der vierten Strophe handelt von dem, was zwischen den Grenzsteinen des Lebens geschieht: als Mündung (das Ziel oder Ergebnis der Sehnsucht des Lebens nach dem Leben) wird die Kunde gegeben, daß keiner entbehren muß. Diese Strophe ist auf ihrer Bildebene ganz im Bereich Mündung/Mund/Kunde/Wange angesiedelt und so in sich sehr stimmig auf die letzte Zeile hin angeordnet: „Daß keiner entbehren muß“. Das Menschenpaar, das sich gefunden hat, erzählt von den irdischen Freuden, die als Ziel („Mündung“) dem Leben den Sinn geben.
Die fünfte Strophe setzt mit dem Abschied ein „Tische, Sessel und Bänke / setzen uns aus“, nachdem die Fülle des Alltags genossen wurde: „Wir kennen die Leute, die Häher, / Wespen und Mücken, / die Nachbarn am Zaun“ (S. 6) und endet in der sechsten und letzten Strophe mit der offenen Vision des Möglichen: „Welch freies Feld / für Kaktusblüten, für Dämmerung, / Mondlicht und jeden Morgen!“
So eröffnet Kolleritsch seinen jüngsten Gedichtband mit einer Eloge aufs Leben – ganz in dem Sinne, wie er in „Über das Kindsein“ (Prosa, 1991) die Freude über noch ungeborenes Leben ausdrückt, als die „Erfahrung einer Welt, die die Fenster offenhielt: die unverschließbare Dimension“ (S. 8).
In den folgenden Gedichten konfrontiert sich Kolleritsch mit dem Anfang und dem Ende des Daseins, macht sich vertraut mit dem Abschied, nähert sich dem Ungewissen, und dazwischen blitzt das Leben.
Wenn wie in „Anblick“ der Wunsch nach Liebe, nach Körperlichkeit ausgedrückt wird, so läßt dies die Melancholie des Todes, welche die meisten Gedichte dieses Bandes bestimmt, nur um so deutlicher hervortreten. Die Schwarzhaarige am Nebentisch weckt Wünsche, zu einer Annäherung kommt es nicht.
Schon im nächsten Gedicht, „Scheu“ (S. 82), ist wieder von der Begegnung mit jenem anderen Bereich die Rede. „Woher du kommst, was du suchst, / ob du den Mond trägst in dir […] Kehre zurück / in das Land hinter den Hecken. / Dort suchen dir Wolken und Schwermut / keinen Namen, du vergehst nicht im Licht.“ Die Gestalt, deren Namen-Wort dem Dichter nicht einfällt („Fliehe vor dem Wort, / das dich verfolgt. / Aber ich weiß nicht, / was ein Wort ist, / oder ich finde dein Wort nicht.“), taucht auf aus Alleen, aus einem Ort, wo Kräuter duften und Vögel sie nicht fliehen. Es könnte ein paradiesischer Ort sein, und das ausgesparte Wort, der Tod.
Der Tod wird in diesen Gedichten aber auch ganz explizit zitiert, wie zum Beispiel in „Zum Bleibenden“ (S. 9). „Der Abschied belebt, das Reifen glückt, / der Tod beginnt zu erzählen, nie schöner / sind die Farben. Er zieht den Weg.“ Der Herbst zeigt das Erreichte auf seinem Höhepunkt und läßt gleichzeitig die Begrenztheit sichtbar werden: „es ist Gereiftes, / sich zu zeigen und zu verschwinden“ und weiter unten: „Überall Überschwang, was sich ins Ende / bewegt, trägt den Widerglanz der Maske“. Aber auch dieses Gedicht endet in der Offenheit des Unbestimmten: „Der Blick ist die Weite“.
In den Tälern der Welt kann als zeitgemäße Auseinandersetzung mit dem Tod gelesen werden, eine Auseinandersetzung, die sich dem Nicht-Wissen-Können aussetzt. Losgelöst von den Riten einer Religion, bleibt der Einzelne allein zurück, ohne Brücke zwischen dem sinnlich Erfaßbaren und dem, was darüber vielleicht hinausgeht. „In den Tälern der Welt“ beschäftigt sich mit Fragen, die aus diesem Sachverhalt auftauchen, klopft die Grenzen ab und behält trotz aller Ungewißheiten einen optimistischen Grundton bei.