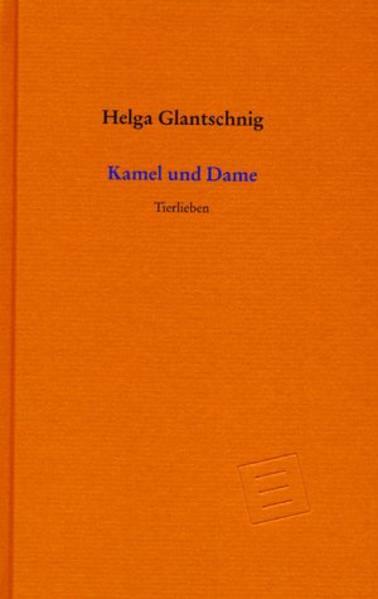Männchen und Weibchen diverser Gattungen kommunizieren ihr Verhältnis, werben, fordern, verbieten, schwärmen, drohen, schmeicheln und nörgeln, träumen und maulen. Da knistert es, da kriselt es, da funkt’s und da stimmt’s. Und auch in der Beziehungsform ist alles drin, was zwei zu bieten haben, vom Pantscherl bis zur zerrütteten Ehe, von den frisch Verliebten zu den alten Gefährten, vom besorgten Elternpaar zum verwegenen Draufgänger-Duo. Direkte Rede und Anrede überwiegen in diesen animalischen Pas-de-deux, Imperativ und Vokativ beflügeln das verbale Balzen; von daher rührt auch die enorme Rufzeichendichte, da vom Lockruf bis zum Warnruf viel Appellierendes Steppe, Meere, Dschungel, Stall und Tiergarten bevölkert.
Doch die klangliche Qualität dieser „Tierlieben“ beschränkt sich nicht allein auf solche Rufe. Eine breite Palette diverser Reime schmückt das akustische Gefieder dieser Gedichte und verleiht ihm bezaubernd schillernden Glanz. Manches Getier verwendet das ihm herkömmlich zugeschriebene Lauten, manchmal verleitet der Klang des eigenen Namens zum „Ausdruck“, wenn der Storch „Och!“ sagt und die Heuschrecke „Hoi“.
Bisweilen erinnert die gereimte Munterkeit, der tierische Non- und doch Sens an Christian Morgenstern, doch die Tierwelt bei Glantschnig ist mündiger als die in den Galgenliedern. Dort ist es immerhin meist eine Art Erzähler, der berichtet von den obskuren Eigenschaften und Begierden einzelner Viecher. Und wenn sie schon einmal als Paar auftreten, dann meist als „bi-speziales“ wie „Geiß und Schleiche“. „Die beiden Esel“ sind eine Ausnahme, doch bleiben diese im Vergleich zu Glantschnigs „Eselin und Esel“ (S. 14) doch sehr reduziert: „Ich bin so dumm, du bist so dumm, / wir wollen sterben gehen, kumm!“, spricht dort ein finstrer Esel, während bei Glantschig gleich das Weib das Wort ergreift, um nach Schimpfen und Gezeter (die Eselsgeduld scheint schon länger am Ende!) schlußendlich zu befinden: „Guten Abend! Gute Nacht! / Meine Liebe ist schachmatt.“ (S. 14)
Die sprachlichen Paarungen bei Helga Glantschnig sind nicht einförmig. So gibt es die (aus Fremdsprachunterricht berüchtigten) Spezialausdrücke für weibliches und männliches Exemplar der Gattung, die klassische Suffix-Form des Weibchens auf „-in“, aber auch die Fabel oder Märchen entlehnte „Frau x“, „Herr y“-Form, die manchmal (wie etwa im Titelgedicht „Kamel und Dame“) kokettiert mit „Mensch und Tier“- Kombinationen, sowie die theoretisch offene (weil nicht explizit „heterosexuelle“) Form „Maus und Maus“, „Maulwurf und Maulwurf“.
Es tummelt sich Heimisches und Exotisches, Säuger, Vögel, Reptilien und Insekten, auch jene Tiere dürfen nicht fehlen, die beim Homo Sapiens gerne als Kosenamen unter jung und „junggeblieben“ Verliebten Verwendung finden (Hase, Maus, Bär, Löwe und Konsorten), ein Beziehungs-Bestiarium globaler Art also. Animalische Pärchen haben ähnliche Sorgen wie die der Menschen-Spezies: Da geht es um Nachwuchs, um Konkurrenz, auch Eitelkeiten haben ihren Platz und werden glänzend ironisiert, wenn etwa ausgerechnet die „Miß Ratte“ (S. 40) gekürt wird und prompt Flausen entwickelt.
Der Mensch stört wenig in diesen Tiergedichten und wird bloß manchmal en passant erwähnt. Bezeichnenderweise im Zusammenhang mit „Papagei“, den wir so lieben wegen seiner Fähigkeit, uns nachzusprechen, und mit „Affe“, der ja sowieso als Verwandtschaft gilt. Die Tiere ihrerseits kennen sich aus in der Menschenwelt, sogar im Fernsehen, und sind keineswegs in einer außerzeitlichen Fabelwelt angesiedelt. So weiß die Delphinin genau, daß der Star ihrer Gattung „Flipper! Flipper!“ ist und bleibt, obwohl auch ihr dessen großer Auftritt „lange her“ scheint.
Die Frau im Hause Tiger ist alleine durch den Reim präsent – sie ist „Siegerin“ in einem Gedicht, das unter anderem fragt: „ist Denken eine Safari?“ (S. 41). „El otro tigre, el que no está en el verso“, suchte Borges einst, der beklagte, daß sein geschriebener Tiger doch immer bloß „un sistema de palabras / Humanas“, „ein Menschenwortspiel“ sei. Körperlosigkeit bedauerte Borges an seinem „tigre vocativo de mi verso“. Glantschnig nimmt diese Hürde unter anderem dadurch, daß nicht ein lyrisches Ich „o Tiger“ spricht, sondern daß sich die Tiere selbst und gegenseitig benennen und anrufen. Dieses hochkultivierte und lustvolle Sprechen macht sie lebendig, die Sprachkompetenz verleiht ihnen Charme und Persönlichkeit. „Menschenwortspiel“ bleiben sie trotzdem, die „Tierlieben“ der Helga Glantschnig, aber: Sie zählen zu den unauffällig prachtvollsten Exemplaren ihrer Gattung.