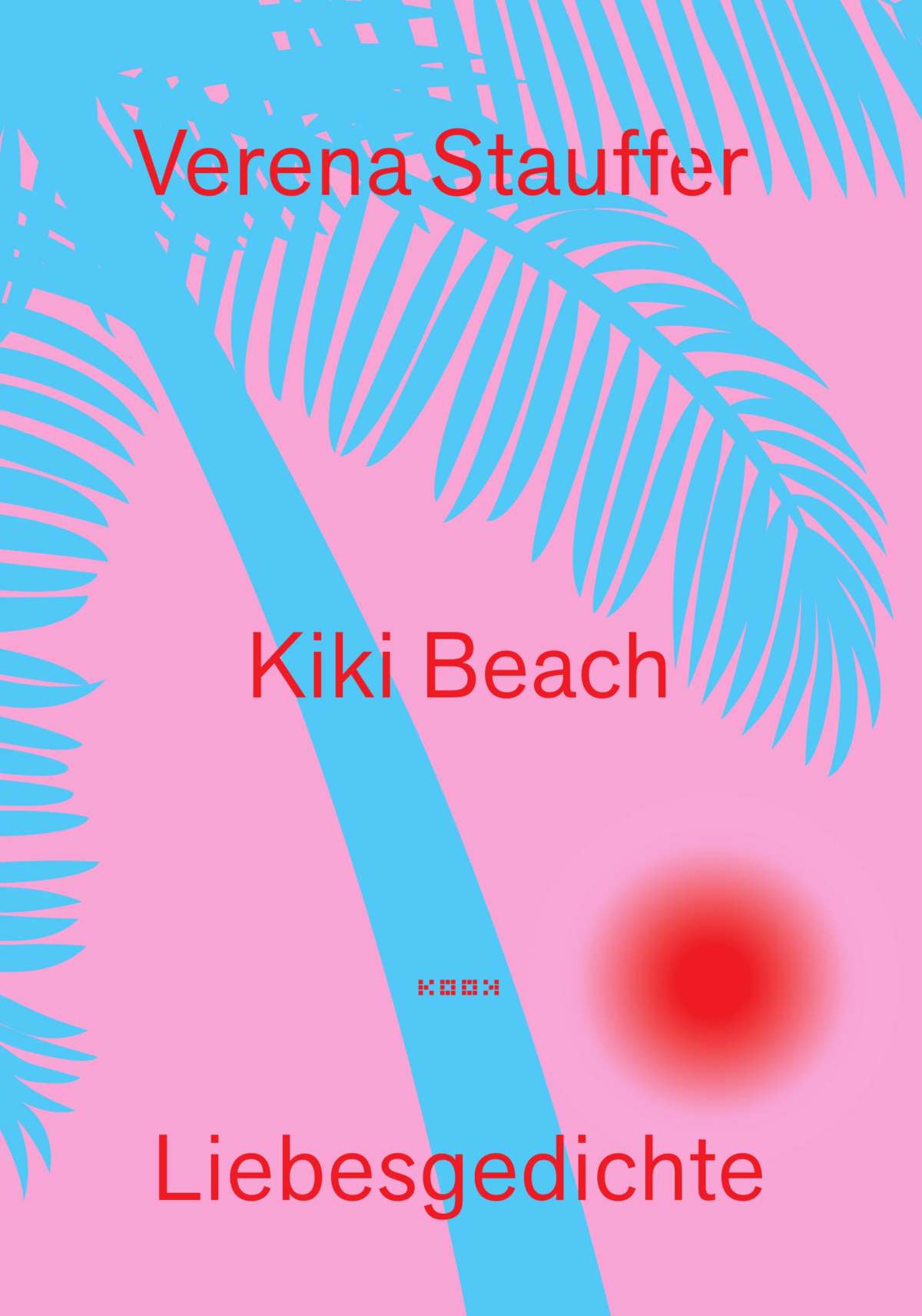Mit „Feuerwerk, Nebelmaschine, rough[en] Beats“ (S. 6), einem pyrotechnischen Spektakel, eröffnet Stauffer ihren Gedichtband Kiki Beach. Der Prolog, der sich mehrheitlich der englischen Sprache bedient, entführt uns in eine Gegenwelt, eine Utopie der Liebe, die frei von der Last der Trauer ist. Die Stimme, die uns mit den ambivalenten Worten „Open your Eyes and Jaws“ (S. 6) empfängt, fordert uns implizit auf, die starren Grenzen zwischen dem Zivilisierten und dem Animalischen zu hinterfragen und uns einer neuen Gegenwart zu öffnen.
In sieben Kapiteln unterteilt – eine Zahl, die seit jeher mit der Liebe assoziiert wird (man denke nur an den ‚siebten Himmel‘ oder die ‚Engelszahl 7′) – entfaltet sich eine (teils fantastische) Reise, die uns von mythologisch-historischen Orten zum Kiki Beach über die Alpen und Persien bis nach Pompeji und in digitale Welten führt. Stauffer verwebt dabei historische und literarische Traditionen mit modernen Figuren, die auch die Welt des japanischen Anime berührt (S. 29).
Ein besonderes Augenmerk gilt den ‚Mitschreibenden‘, jenen Dichter:innen und Autor:innen, die Stauffer am Ende ihres Bandes als ‚Featuring‘ auflistet: Yi Lei, Walt Whitman, Dylan Thomas, Eavan Boland, Oscar Wilde, Bianca Stone und Travis Scott. Sie sind nicht nur Inspirationsquellen, sondern treten mit Stauffers Texten in einen Dialog, der sich in zahlreichen Referenzen manifestiert. So finden sich Anspielungen auf den Roman Teleny1, auf Dylan Thomas‘ Gedicht Do not go gentle into this good night oder auf Georg Friedrich Händels Oper Serse, die mit Ombra mai fù eine von Stauffers Lieblingsarien enthält.
Die Auseinandersetzung mit der irischen Dichterin Eavan Boland reflektiert Stauffers poetologische Sensibilität, indem sie die Frage nach dem Naturgedicht und dessen Abgrenzung zum Liebesgedicht aufwirft. Denn in Stauffers Universum ist Liebe mehr als eine bloße zwischenmenschliche Erfahrung, vielmehr wird die Pflanzen- und Tierwelt zu einem integralen Bestandteil ihrer Liebesdarstellungen: sich wie suchende Finger neigende Palmenblätter (S. 39), die Liebe zur Platane, die Xerxes (der Titelheld aus Georg Friedrich Händels Oper Serse) mit silbernen Herzen schmückt und die ihm Schatten spendet (S. 30ff), die Ziege als mythologische Amme des Zeus und der liegende Capride, der oft in Begleitung einer nackten Göttin Darstellung findet (S. 54).
In einem konzeptionellen Bogen, der die anfängliche Paarbindung mehrdimensional entfaltet, wird Liebe im Verlauf der Lektüre auf (un)erwartete Weise komplexer. Im Kapitel „Kinky Bitch“ entfesselt Stauffer erotisches Potenzial – sowohl aus weiblicher wie männlicher Perspektive – und befasst sich mit Themen wie Schwangerschaft, digitaler Erotik und unterschiedlichsten Körperflüssigkeiten. Es geht ums Stillen, um Gelüste, um Nähe und Dominanz, die die gewohnten (Liebes)Bilder hinterfragt und neu erfindet.
„Begehren ohne Besitz sprüht / Begehren ohne Verlangen strahlt / Begehren ohne schnelle Erfüllung expandiert / Begehren bis zur Ekstase, Ekstase, Ek…“ (S. 43) oder „Give me what I never had“ (S. 41). Hier mag die Utopie, die mit dem metaphorischen Feuerwerk eröffnet wurde, zwar temporär realisiert erscheinen, wenn weibliche Dominanz herrscht und sexuelle Begierde und die gemeinsam auf Augenhöhe stattfindende Liebe in Einklang kommen, jedoch bleibt die Utopie stets fragil. Die aufkommende Trauer trübt sie, da die Realität immer mehr in den Vordergrund rückt und sie verzerrt.
Diese Widersprüchlichkeit spiegelt sich auch im Gedicht Sailing the Situationship (S. 26) wider, die in dem Vers „sailing the clearest ocean / Ein neuer Anfang, ohne Verantwortung, ohne Zusage“ thematisiert und gleichzeitig mit einem Augenzwinkern humorvoll anzweifelt wird. Hände, die sich gegenseitig festhalten möchten, stehen im Spannungsfeld zu einer zugleich artikulierten Abkehr von zukünftigen Hoffnungen (scheinbar ganzer Generationen). Doch der menschlichen Vorstellungskraft sind keine Grenzen gesetzt: „Gedankenbilder formen sich am Screen / Fantasien für eine neue Welt, ich lebe da jetzt / Erfüllung im virtuellen Traum.“ (S. 39). Es könnte zwar als Flucht vor der Realität gelesen werden, jedoch spätestens im Gedicht Garden of Orchids wird klar: „Virtualität und Realität – beides ist echt“ (S. 43), sodass sich diese Welten nicht abgrenzen lassen, sie existieren parallel und wir in ihnen – ganz real.
Die Auflösung, die mit dem Begriff „Trick“ eingeführt wird und den Leser:innen erlaubt, hinter die Magie zu blicken, ist ebenso ein Indiz für das Vorgetäuschte in menschlichen Beziehungen und das damit verbundene Scheitern, das jedoch der literarischen Utopie keinen Abbruch tut. Denn das Spektrum, das Stauffer ihren Leser:innen offenbart, in dem Liebe und Trauer, Höhenflug und Schmerz – jeweils zwei Seiten einer untrennbar verbundenen Einheit – herrschen, gehört zum Leben dazu. Und erinnern stets daran, dass es beides gibt und braucht, man sich aber dennoch zwischenzeitlich Illusionen erlauben muss (die hier als Utopie ins Spiel kommen) – denn wer lebt schon gerne ohne Illusion, wie Edward Albee einmal fragte.
Die Fußnoten, die Stauffer in ihren Text einwebt, schaffen eine zusätzliche Ebene in ihren Gedichten: Sie bieten Einblicke in ihr Denken und Schreiben und begleiten die Leser:innen durch das Buch. Anekdoten zur Entstehungsgeschichte der Gedichte werden ebenso preisgegeben wie Verweise auf die griechische Mythologie, literarische Vorbilder und künstlerische Einflüsse – etwa durch die Fotografin Angela Andorrer, die Stauffer neben einer toten Ziege am Steinstrand von Kroatien abgelichtet hat.
Gerade das Kapitel „GOAT. Über das Metrum und was die tote Ziege bisher gesagt hat“ kann als eben diese Metaebene – wie die Fußnoten – gelesen werden – übrigens der einzige deutliche Prosateil neben der Gedichtsammlung. Es eröffnet uns das reale Zusammentreffen zwischen der (mythologisierten) Ziege und der Autorin (bzw. scheint es uns dieses zu eröffnen). „Eine tote Ziege am Felsstrand. Sie liegt auf zerklüfteten schwarzen Steinen, als wären sie ein weiches Bett. Nicht so, dass man sich abwenden möchte. Etwas hält einen, als würde sie sich mitteilen wollen.“ (S. 51) Geschickt werden hier die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verwischt – gibt es doch die Fotografie, neben dem literarisch (fiktiven) Text.
Stauffer offenbart zudem ihre eigene Perspektive auf die Sprache und ihre Formsuche: „Je mehr Referenzen ich entdecke, je mehr ich meine eigene Sprache in die Sprache anderer einbetten kann, desto geborgener und sicherer fühle ich mich. Es bewirkt eine Ausstrahlung der Sprache in alle Zeiten, was eine Aufhebung der Zeiten bedeuten kann.“ (S. 14).
Diese Einblicke sind von unschätzbarem Wert und erlauben, die Vielfalt der Referenzen und Beziehungen in Stauffers Gedichte zu erfassen. Zu den wenigen Schwachstellen von Kiki Beach gehören Stauffers Versuche, Jugendsprache und ausschließlich in Englisch geschriebene Gedichte in den Band zu integrieren. Der teilweise klug gesetzte Sprachwechsel, der durch digitale Kommunikation und das Internet verstärkt geprägt ist, wirkt an den Stellen tiefgründig und stimmig, an denen auch die auf Deutsch verfassten Gedanken hinzutreten dürfen; dort, wo ausschließlich das Englische steht, oder Sprechweisen von Jugendlichen (mit Augenzwinkern, wie ich hoffe) hinzugefügt werden, muss man leider von eher banalen (teils in Kreuz- oder Paarreimen geschriebenen) Gedichten sprechen, die nicht die emotionale Tiefe anderer Texte haben.
Hier zwei Strophen als Beispiele:
„Dr., Dr., just come over
Dr., Dr., ring my bell
Dr., Dr., take my clothes off
Dr., tell me that I’m well” (S. 60)
„Wo einmal auf Äckern Weichweizen sich bog, yo
Wo einmal auf Steinen ein Bächlein sich zog, Bro
Wo einmal ein Rainbow sich in Erde ergoss, yeah
Wo früher an Neujahr eine Glücksträne floss, oh“ (S. 62)
Schließlich wird auch die verengte politische Weltlage am Ende nicht ausgespart, bleibt jedoch eher im Hintergrund – wenn sie in einem der letzten Gedichte die vielen aktuellen Brandherde anspricht:
„Ziege, sprich, wie sind die Konflikte zu lösen?
Israel, der Iran und Jemen, Juden und Muslime
Russland, Ukraine, Grenzen, Werte, Religionen
Eine Welt eskaliert. Holt Nathan, den Weisen
Jedem sein Land, keinem ein Gott?“ (S. 66)
Ein Wagnis, das nicht unbedingt erforderlich gewesen wäre, jedoch die Vielschichtigkeit offenbart, die die digitale Welt bereithält.
Insgesamt ist Verena Stauffers Kiki Beach fulminant und beeindruckt mit einer unvergleichlichen Stimme, die die Liebe in all ihren Facetten – von sinnlicher Ekstase bis hin zu tiefster Melancholie – zelebriert. Sie scheut sich nicht, die Grenzen zwischen Hoch- und Popkultur sowie zwischen Mythos und Moderne zu verwischen, wodurch sie ein einzigartiges poetisches Universum schafft. Kiki Beach ist ein Fest der Sprache, ein Triumph der Imagination und ein unvergessliches literarisches Ereignis, das gefeiert werden muss!
1 Teleny ist ein 1893 anonym in London veröffentlichter Roman, der Oscar Wilde zugeschrieben wird, dessen Autorschaft jedoch nicht gesichert ist. Der Roman, auch bekannt als Teleny, or: The Reverse of the Medal, erzählt die homoerotische Liebesgeschichte zwischen dem französischen Dandy Camille und dem ungarischen Pianisten René (Teleny), deren Beziehung an gesellschaftlichen Repressalien scheitert.