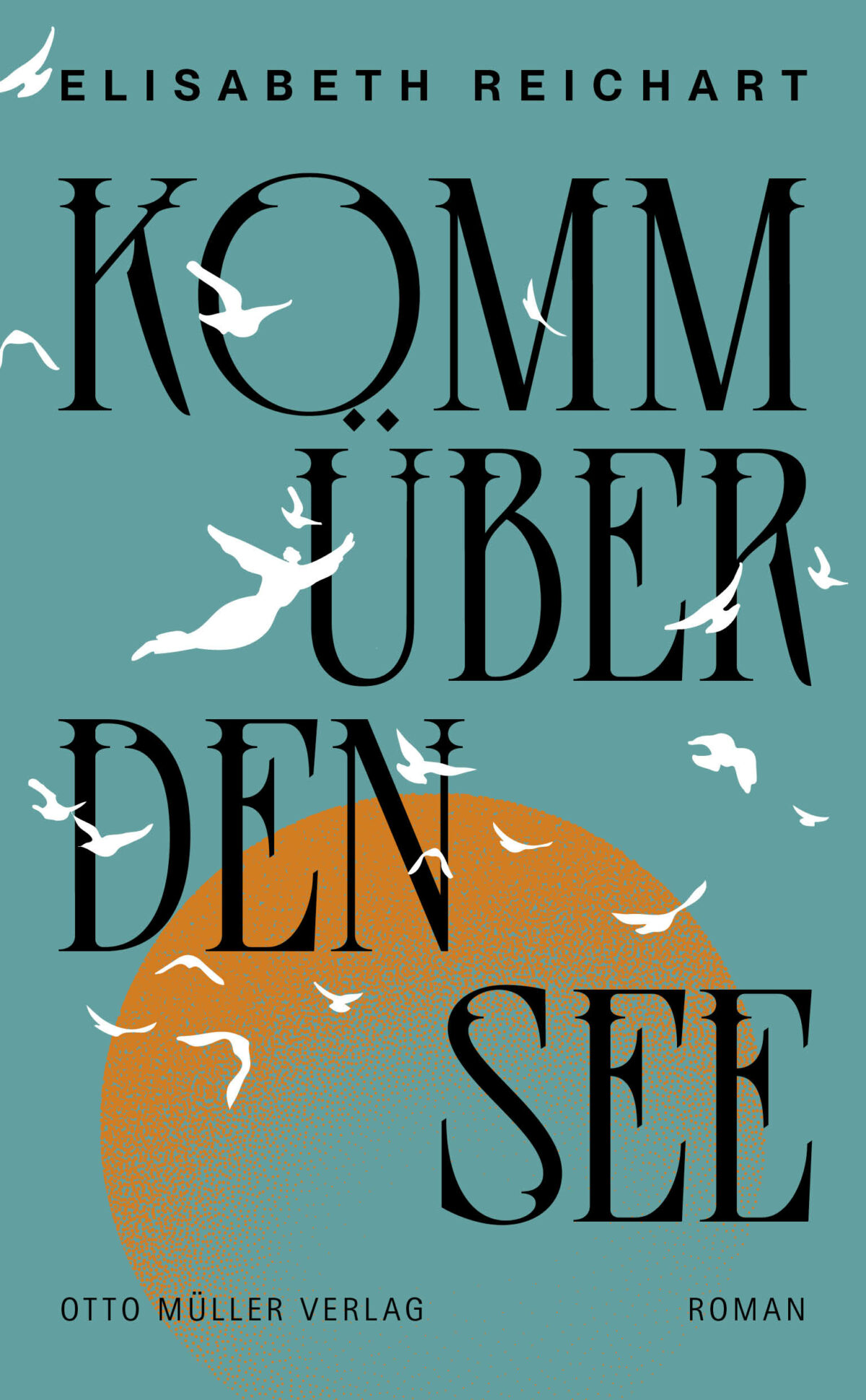Im Jahr 1988 erschien die Erstausgabe von Komm über den See im S. Fischer Verlag. 2001 wurde es vom Deuticke Verlag neu aufgelegt, der inzwischen in der Marke Zsolnay aufgegangenen ist. Eine vollständig überarbeitete und erstmalig als Roman bezeichnete Neuauflage erscheint nun dieses Jahr im Otto Müller Verlag. Zum Glück und, wie es scheint, zur passenden Zeit!
Wie auch in anderen Werken setzt sich Elisabeth Reichart in Komm über den See mit der nationalsozialistischen Vergangenheit in (Ober-)Österreich auseinander und mit dem Widerstand gegen das NS-Regime. Die Autorin ist wie die Hauptfigur des Romans Historikerin und dissertierte 1983 mit Heute ist morgen. Fragen an den kommunistisch organisierten Widerstand im Salzkammergut.
Zwischen den fünf Abschnitten von Komm über den See stehen kurze, kursiv gesetzte Textstellen, die die Erlebnisse und Gedanken einer Widerstandskämpferin wiedergeben.
Frauen stehen im Fokus des Romans: Als Unterstützerinnen ihrer Männer, die Widerstand gegen das NS-Regime leisteten, als eigenständige Kämpferinnen und sich dem Willen der Männer Verweigernde, als Freundinnen und Arbeitskolleginnen, als Verbündete und Verräterinnen, als Großmütter, Mütter und Tanten stellen sie das Beziehungsgeflecht rund um die Protagonistin Ruth Berger dar, aus deren Perspektive erzählt wird.
Die Handlung setzt ein, als Ruth erfährt, dass ihr Probejahr als Lehrerin nicht – wie erhofft – in einem Dienstverhältnis mündet, sondern in der für sie höchst belastenden Situation „arbeitslos mit fünfundvierzig!“ (S. 8)
Früher, so erfahren wir im Lauf des Textes, arbeitete Ruth als Dolmetscherin für eine Firma, die von einem großen Konzern übernommen wurde. „Seit wann, hast du dich schließlich gefragt, übersetze ich nicht mehr die elektronischen Daten für einen neuen Bremsenprüfstand, sondern für einen neuen Panzertyp, und die Panzer waren ja erst der Anfang der Kriegsproduktion, …“ (S. 88) Das schlechte Gewissen in Form einer chronischen Entzündung der Mundhöhle zwang Ruth schließlich, diese Arbeit aufzugeben. Von ihrem Mann, einem Richter, hat sie sich scheiden lassen, unter anderem weil er andere wegen Suchtmittelkonsums verurteilte und selbst Suchtmittel konsumierte.
Während Ruth in Wien von Behörde zu Behörde läuft und hofft, auch ohne Parteibuch einen Posten als Lehrerin zu bekommen und den Briefträger aus Verzweiflung schon ins Wirtshaus verfolgt, meldet sich ein Bekannter aus dem Übersetzungsbüro. Er bittet sie, seine Mitarbeiterin Martha zu vertreten, da diese sich in der Psychiatrie befinde. Ruth hat Martha vor einiger Zeit kontaktiert, um mehr über Marthas Mutter, eine Widerstandskämpferin herauszufinden. Die Widerstandskämpferinnen der (NS-)Vergangenheit, so erfahren wir schließlich, sind die wichtigsten Bezugspersonen in Ruths Leben, nicht zuletzt, weil ihre Mutter vielleicht eine von ihnen war.
Das Unwissen und das Schweigen über die Geschehnisse von damals, die Suche nach der Erinnerung an das, was in Ruths früher Kindheit, während und nach dem Krieg mit ihr und ihrer Mutter geschah, ist es, was Ruth und den Text vorantreibt.
„Saß nur da und starrte die Gartentür an, wie viele Tage lang. Erinnerte sich das Kind an seinem Fensterplatz an die Verhaftung der Mutter? Hatte es einen Namen für den Vorfall? War das Gefühl, die Mutter im Stich gelassen zu haben, erst entstanden, als die Mutter wieder zu Hause war und das Kind die eigene Mutter nicht wiedererkannte, oder entstand es gleich, als das Kind ihr gehorchte und weglief. Sie waren spazieren gegangen, plötzlich sprangen zwei Männer aus einem Auto […] das Gesicht der Mutter war blutverschmiert, aber sie konnte noch schreien, schrie: „Lauf weg! Lauf!“, und als sich nun doch einer der Männer nach dem Kind umdrehte, nach ihm griff, begann es zu laufen, lief und lief und läuft und läuft, dachte Ruth, wenn ich nicht gerade warte.“ (S. 12f)
Als Ruth schließlich doch den Ruf in eine Schule in Gmunden erhält, fällt ihr eine Schachtel voll Ansichtskarten von Gmunden ein, die ihr aus dem Nachlass der Mutter geblieben war. Mit den für sich alleine im Text stehenden Worten „Komm über den See“ (S. 42) endet der erste Abschnitt.
Während Ruth im zweiten Abschnitt durch die Kleinstadt Gmunden läuft und auf den Beginn des Schuljahrs wartet, macht sie Bekanntschaft mit einem für den ORF tätigen Redakteur, der ihr von seinen Recherchen erzählt, deren Ergebnisse der ORF nicht veröffentlichen will: Ein Gemeinderatsmitglied der FPÖ feiert jährlich ganz öffentlich im Gasthaus die sogenannte „Reichskristallnacht“. „Alles wie ehemals, vom Unternehmer bis zum Staatsanwalt, vom Bürgermeister bis zum Gemeindesekretär, vom Wirt bis zum Arzt.“ (S. 57)
Der dritte Abschnitt beginnt – ähnlich dem ersten – mit Ruths Eintreten ins Konferenzzimmer. Erwartet wird sie von Dämmerlicht, präpotenten, vorwiegend männlichen Kollegen und einem übergriffigen Direktor. Dieser stellt sie der gesamten Kollegenschaft als die Tochter des berühmten Schauspielers Schwarz vor, einem, wie wir nach und nach erfahren, Karrieristen und Opportunisten, der als Nazi-Kollaborateur Karriere machte und sich nicht für seine Tochter interessierte. Ruths Mutter hatte sich geweigert, mit ihm nach Berlin zu gehen.
Unter der Kolleg:innenschaft befindet sich aber auch die gleichaltrige Susanne Fischer, die schließlich trotz Ruths Argwohn zu einer Freundin wird. Die Bekanntschaft zu Susannes Sohn, der mit Ruth über den See (!) segelt, wird vom Direktor unterbunden. Sich als Lehrerin mit einem jüngeren Mann sehen zu lassen, schicke sich nicht.
Im vierten Abschnitt erfahren wir immer mehr über die Brüche und Traumata aus Ruths Kindheit und Jugend, erfahren über die als „Moor“ bezeichnete Neigung zu Depression, über die große Einsamkeit nach der Rückkehr und dem Tod der Mutter und der immensen Anpassungsleistung, die das Kind, die Jugendliche und die Erwachsene Ruth leistete, um zu überleben. Wir erfahren von Ruths Schuldgefühlen, nicht nur gegenüber ihrer Mutter, und gegenüber Martha, sondern auch gegenüber ihrer Mitbewohnerin Eva aus der Studienzeit, die Selbstmord verübte. „Du bist für alle Sprachen begabt, außer für deine eigene“ (S. 39), hören wir schon im ersten Abschnitt einmal Evas Stimme.
Immer wieder werden Stimmen erwähnt, die Ruth in ihrem Kopf vernimmt, Stimmen der anderen, aber auch verschiedene Stimmen, mit denen sie zu sich selbst spricht und versucht, sich der eigenen Geschichte und der Geschichte ihrer Mutter anzunähern. Eine der Stimmen ruft immer wieder einen Namen, der ihr fremd und gleichzeitig vertraut ist: „Brigitta“.
Im fünften Abschnitt überwindet sich Ruth schließlich, die im Ort ansässige Widerstandskämpferin Anna Zach aufzusuchen, die, wie unter anderem die gefunden Ansichtskarten aus Gmunden andeuten, ihre Mutter kannte. „Was hat die Mutter über Anna Zach erzählt? Waren die beiden Freundinnen? Hatte die Mutter etwas mit dem Widerstand zu tun? In Wien oder hier? Wurde sie deshalb verhaftet?“ (S. 143)
Die Antworten auf diese und andere Fragen, die schließlich alle Fäden der Erzählung zusammenführen und die Komposition vollenden, sollen an dieser Stelle nicht verraten werden.
Von den ersten Seiten an erzeugt die Sprache, die mit inhaltlichen Sprüngen und wechselnden Pronomen arbeitet, einen Sog. Genauso wie die Protagonistin Ruth wollen wir die Wahrheit herausfinden und haben gleichzeitig Angst davor.
Es ist bewundernswert, wie es der Autorin gelingt durch Ruths Gedanken und Wahrnehmungen, die stets zwischen erzählter Gegenwart und der erinnerten Vergangenheit, zwischen Schlaf und Wachzustand, zwischen Traum und Realität hin und her pendeln und im Laufe des Textes immer schneller um die zentralen Themen kreisen, nicht nur die Geschichte von Ruth mehr und mehr offenzulegen, sondern auch die verdunkelte, verdrängte und dennoch bis heute aktuelle Geschichte unseres Landes.
Vorhergehenden Ausgaben von Komm über den See ist das Gedicht Anziehung von Sarah Kirsch vorangestellt, dem das titelgebende Zitat entnommen ist: „Nebel zieht auf, das Wetter / schlägt um. Der Mond versammelt / Wolken im Kreis. / Das Eis auf dem / See hat Risse und reibt sich. / Komm über den See.“
Die Neuausgabe beginnt nun ohne Gedicht, direkt mit dem im Buch mehrmals wiederholten, aber jedes Mal verkürzten Satz: „Vor jeder Erinnerung das Wissen: Alle Sätze in dieses Gestern können nur Brücken zu Inseln sein, was sie verbinden, es bleibt für immer getrennt.“ (S. 5f., 43, 75, 105) Elisabeth Reichart gelingt es, diesem Satz zum Trotz, eine Verbindung herzustellen.
Komm über den See von Elisabeth Reichart sollte Pflichtlektüre an österreichischen Schulen sein.
Barbara Rieger (* 1982) ist Autorin, Schreibpädagogin und Herausgeberin.
https://www.barbara-rieger.at/