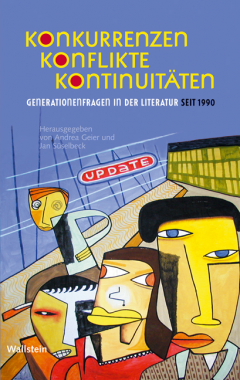Mit der angesprochenen wie ähnlichen Etikettierungen („Generation Golf“, „Generation Praktikum“, …) wird eine soziologische Aussagekraft suggeriert, die so nicht gegeben ist. Es handelt sich um zweifellos die Aufmerksamkeit steigernde, gleichwohl problematische, weil unscharfe Zuordnungen, und das durchaus auch in wissenschaftlichen Publikationen. Der Begriff bleibt, wie Herausgeberin und Herausgeber der im vorliegenden Band versammelten Beiträge einer Marburger Tagung in ihrer Einleitung feststellen, „höchst erklärungsbedürftig“. Dies verwundert, haben sich doch von Wilhelm Dilthey über Karl Mannheim bis Aleida Assmann und Sigrid Weigel klügste Köpfe mit der Generationenproblematik befasst.
Die vorliegende Publikation nun macht es sich zur Aufgabe, diesen Begriff, der auch im Kulturbetrieb zur angesprochenen Steigerung des Marktwertes der jeweils mit ihm bedachten Produkte Konjunktur hat, im Hinblick auf seine Tauglichkeit und Treffsicherheit zur Beschreibung von Phänomenen der deutschen Literatur der letzten zwei Jahrzehnte zu befragen. Das Erkenntnisinteresse wird dabei in je einem Kapitel auf vier Problemfelder gelenkt mit „Rückblicken auf den Nationalsozialismus und die alte Bundesrepublik“, mit „Rückblicken auf die DDR und die ‚Wende'“, mit einer Bilanzierung der „Pop-Literatur“ sowie mit einem Beitrag über den „Generationenbegriff in der ‚türkischdeutschen‘ Literatur“.
Ein grundlegender Beitrag von Thomas Anz über „Generationenkonstrukte. Zu ihrer Konjunktur nach 1989“ ist den angeführten Kapiteln vorangestellt. Zu Recht stellt er fest, dass die Rede von „Generation“ auf Familien bezogen einen sowohl biologischen als auch kulturellen Sachverhalt trifft, dass dieser Begriff jedoch in Bezug auf gesellschaftliche Belange nur metaphorisch und „eigentlich ziemlich verrückt“ verwendet wird, weil sich „eine Gesellschaft […] biologisch nicht in Zyklen reproduziert, sondern kontinuierlich“. Anz befragt verschiedene generationenbezogene Konstruktionen, von der „verlorenen Generation“ über die „Flakhelfergeneration“, die Generation der 68er bis hin zu den 89ern, der ersten der Generationen nach 1945, die – hierin folgt Anz einer Auffassung von Iris Radisch – nicht mehr obsessiv auf die deutsche Vergangenheit blicke. Grundsätzlich hält er fest, dass die genannten wie auch andere Konstrukte nur sehr bedingt der jeweiligen historischen Komplexität gerecht werden, dass „intellektuelle Umbrüche“ nur sehr selten „Brüche zwischen Generationen“ sind. So haben beispielsweise Autoren wie Peter Handke oder Botho Strauß schon vor 1989/90 einen Wandel weg vom 68er-Umfeld vollzogen, dem sie generationsmäßig zugehören. Generationenspezifische Literaturgeschichtsschreibung verfahre, so hält Anz nachdrücklich fest, naturgemäß simplifizierend – aber so verfahren ja auch Epochenkonstruktionen.
Mit der Wende 1989/90 machen sich – nach dem von Anz und Radisch Gesagten wenig überraschend – Umbrüche in der Erinnerungskultur bemerkbar. Dietmar Till verfolgt mit Blick auf „Vergangenheitsdiskurse im Generationenroman“ (am Beispiel von Modick, Timm u. a.) „Kontroversen im Familiengedächtnis“. In der Forschung hat Erinnerungsproblematik Hochkonjunktur, geprägt vor allem durch die Arbeiten von Jan und Aleida Assmann, deren Begriffe „kommunikatives“, „kollektives“, „kulturelles Gedächtnis“ den Diskurs beherrschen. Deren Auffassung, dass jeweils drei Generationen eine „Erfahrungs-, Erinnerungs- und Erzählgemeinschaft“ bilden, übernimmt Till, ohne sie (etwa im Sinne von Anz) zu problematisieren. In der Erinnerungsliteratur der letzten zwei Jahrzehnte beobachtet er Verschiebungen im „kollektiven Gedächtnis“, vor allem durch Tabubrüche, durch Ironisierung, thematische Neuausrichtungen (auf den Schuldanteil der deutschen Wehrmacht, auf Bombardements durch die Alliierten, auf Vertreibungen Deutscher aus den Ostgebieten) oder Ausklammerung des Politischen aus individuellen Erfahrungen und Erinnerungen. Dabei erweist sich der Spielraum der Literatur im Vergleich zur Geschichtsschreibung dank unterschiedlichster Narrative als erstaunlich groß. Die Beobachtungen Tills werden gut ergänzt durch jene von Jan Süselbeck, der sich mit sehr unterschiedlich zu bewertenden Erzählungen der „Enkelgeneration“ über den Nationalsozialismus am Beispiel der 2004 erschienenen Anthologie Stadt Land Krieg auseinandersetzt. Neben „verharmlosend“ problematischen Texten finden sich „innovativ[e]“ Ansätze: am spannendsten erscheinen jene Texte, denen „eine Art Lähmung der nachgeborenen Deutschen“ eingeschrieben ist, die sich im eigenen Familienkreis mit Verbrechen der nationalsozialistischen Zeit konfrontiert finden. Einem Problem ganz anderer Art widmet sich die Schriftstellerin Tanja Dückers, die den im Umfeld der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland neu aufflammenden, allenthalben als „harmlos“ eingestuften Nationalismus brandmarkt, einem – wie ihn Katrin Passig nennt -„postpatriotischen Partyotismus“ (da fällt es nicht leicht, sich ein Wortspiel zu verkneifen). Dass damit xenophobe Tendenzen kaschiert werden und auch Autoren einem bedenklichen Sprachgebrauch unsensibel begegnen, ist gesellschaftlich durchaus alarmierend, allerdings auch wenig erhellend für die jüngsten Entwicklungen in der Literatur.
Elke Brüns stellt die Frage, ob die 89er als „Generation DDR?“ gelten können. In rückblickenden Erzählungen über Kindheit und Jugend im ostdeutschen Staat zeigen sich allerdings gravierende Unterschiede bei Autoren mit nur geringem Altersunterschied. Für Thomas Brussig, Jahrgang 1965, stellt sich in der subjektiven Erinnerung, ohne die DDR verklären zu wollen, die Sozialisation als spannender heraus denn im Westen; Jakob Hein, geboren 1971, nivelliert in seinen Texten doch etwas fragwürdig die Differenzen, während sie Jana Hensel, Jahrgang 1976, nachdrücklich betont. Der Generationenbegriff erwiese sich, so gesehen, wenig ergiebig, würden sich nicht alle drei in den „Pop-Diskurs“ einschreiben – womit sie allerdings auch wieder mit dem Westen verbunden sind und der Begriff „Generation DDR“ wohl nicht greift.
Verschiedenen „Paradigmen der Identitätskonstruktion in der ostdeutschen Literatur nach 1989“ widmet sich Ilse Nagelschmidt. Gegen eine „verordnete“ vor der Wende lässt sich mit dieser dann vorerst kurzzeitig ein „Wir-Konzept“ beobachten, das mit der so genannten Wiedervereinigung und der Einengung des ökonomischen und gesellschaftlichen Spielraums für Ostdeutsche abgelöst wird von der Arbeit am „kollektiven Gedächtnis“, worin sich mehrere Generationen von Autorinnen und Autoren trotz ihrer unterschiedlichen Erfahrungen treffen. Stärker betont die Generationendifferenzen Andrea Geiger, deren Interesse aber eher auf intertextuelle Bezüge ausgerichtet ist, etwa auf den (durchaus nicht unkritischen) Bezug auf Fontane, um über den Umbruch zu erzählen, oder auf Goethes Faust, um gegen Wendeeuphorie und Besserwessis anzuschreiben.
Drei Beiträge befassen sich mit der Pop-Literatur seit 1990, alle drei problematisieren diesen Begriff, über den Einigkeit zu erzielen wegen unterschiedlicher Zuschreibungen kaum möglich ist. So führt Heinrich Kaulen außer drei bevorzugten narrativen Modellen, die er selbst als „idealtypisch“ für die Pop-Literatur der 1990er Jahre charakterisiert, fünf nicht gerade scharf abgrenzende Merkmale an (thematische Ausrichtung auf Jugendproblematik, jugendliche Zielgruppe, „institutionelle Grenzüberschreitung“, strukturelle Nähe zur übrigen Pop-Kultur, neues Autorbild), polemisiert Jörg Sundermeier gegen das Selbstverständnis der Pop-Literatur als apolitisch und auch als antibürgerlich, wiewohl sie „erzbürgerlich“ sei, und fragt Heinz Drügh, Vergleiche ziehend zur Pop-Literatur der 1960er Jahre, nach ihrer Vereinnahmung durch die Warenwelt, der Nähe zur Werbung, wenngleich er sie gegen eine voreilige Abwertung als bloß affirmativ verteidigt. In einem scheint zumindest Einigkeit zu bestehen, nämlich darin, dass Pop-Literatur nicht auf eine Generationenfrage zu beschränken ist.
Ein abschließender Beitrag befasst sich mit dem „Generationenbegriff in der ‚türkischdeutschen‘ Literatur“. Eine grundlegende Differenz zu jener Generationenzählung, die von 1945 beziehungsweise von der Auseinandersetzung mit den Verbrechen des Nationalsozialismus ausgeht, ist für die „türkischdeutsche“ gegeben, für die 1961, das Jahr, in dem das „Abkommen zur Anwerbung von Arbeitskräften“ abgeschlossen wurde, der Ausgangspunkt ist. Daraus resultieren auch differente Geschichtsnarrative, transgenerationelle und transnationale Erinnerungsarbeit.
Insgesamt kann dem Band bescheinigt werden, dass er der doppelten Zielsetzung einer widersprüchliche Sehweisen durchaus offen haltenden Zwischenbilanz sowie der Anregung weiterer Diskussion über die Relevanz von Generationenfragen in der jüngsten Literatur gerecht wird, und auch eine Anregung darstellen könnte, den Blick auf Schweizer und österreichische Literatur auszudehnen.