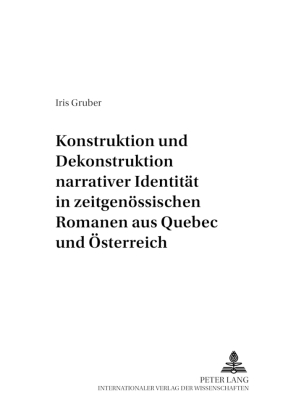Die Zusammenstellung verwundert. Denn die Differenzen zwischen Québec und Österreich sind ja nicht nur im Hinblick auf die (Nicht-)Eigenstaatlichkeit unleugbar groß. Vergleichbarkeiten tun sich dennoch auf, etwa in der geographischen Größe und der Einwohnerzahl sowie – auf die Literatur bezogen – in der Position gegenüber einem dominanten literarischen Markt, dem frankreich-französischen dort, dem deutschen hier. Nähe (Österreichs zu Deutschland) und Distanz (Québecs von Frankreich) mögen (in der Frage der deutlichen Abgrenzung, der Marktstrategien etc.) eine nicht unwichtige Rolle spielen, jedenfalls aber für die québecische die Konkurrenz der anglo-amerikanischen Literatur. Deutlich hat sich die Suche nach einem eigenen Profil nicht erst in Veranstaltungen der 1990er Jahre, dem Österreich-Schwerpunkt bei der Frankfurter Buchmesse 1995 und im Pariser Salon du Livre 1999 niedergeschlagen, sie findet sich den beispielhaft behandelten Texten deutlich eingeschrieben.
Der Titel von Grubers Untersuchung weckt ambivalente Erwartungen, einerseits darf man annehmen, dass sich interessante Einblicke auftun aufgrund des ungewöhnlichen komparatistischen Unterfangens, Texte aus der französischsprachigen kanadischen Literatur mit solchen aus Österreich zu vergleichen, andererseits lässt er selbstzweckhafte szientifische Ausdrucksweise befürchten. Beide Erwartungen werden erfüllt. So ist es zweifellos lobenswert, dass die Verfasserin mit heißem Bemühen diverse Theoretiker von Lotman über Bachtin, Adorno, Ricooeur, Lacan, Foucault, Deleuze und Guattari, Derrida, Genette, Bourdieu, Aleida Assmann bis Welsch u.a. studiert hat – eine durchaus beeindruckende Leistung. Gruber operiert denn auch trefflich mit Worten, über weite Strecken allerdings am Thema vorbei. Fraglich, was ein mit Bedeutung auf-, um nicht zu sagen überladener Begriff wie „Transdifferenz“ bringen soll, von dem die Verfasserin ausdrücklich feststellt, dass er sich nur unscharf von der Derridaschen „différance“ abgrenzen lasse und der dann auch noch fast synonym gebraucht wird mit „Nomadisieren“. Was Gruber tut, ist nicht untypisch für Doktorarbeiten (eine Erlanger Dissertation liegt denn auch dem Buch zugrunde), nämlich das demonstrative Ausstellen der theoretischen Kenntnisse. Um nicht missverstanden zu werden: Selbstverständlich ist das Studium der Theoretiker Voraussetzung, aber eben Voraussetzung und nicht Selbstzweck. Zudem braucht nicht jede wissenschaftliche Studie eine Einführung in die Literaturwissenschaft zu sein und einzelne Theorien ab ovo vorzustellen, und das auch noch mit einigermaßen ermüdenden Redundanzen (darauf sollten eigentlich Betreuer von Doktorarbeiten achten).
Eine Beschränkung auf ein oder einige wenige theoretische Konzepte, etwa auf das von Bourdieu, hätte der Arbeit gut getan. Gruber gelingt zwar der Ansatz zu einem Vergleich der literarischen Felder Québec und Österreich (im Bourdieuschen Sinne), aber eben nur ein Ansatz, weil sie sich zu sehr in Beachtung unterschiedlicher Aspekte verliert, wie die folgende (vergleichsweise eher noch nachvollziehbare) summarische Feststellung beispielhaft erkennen lässt: „Alle vier Texte weisen Schwerpunktsetzungen auf räumliche Strukturen auf. Das entspricht den poststrukturalistischen Theorien Deleuzes und Guattaris, aber ebenso dem Konzept vom literarischen Feld, in welchem Werk und Autor zu positionieren sind und nicht zuletzt der Idee der Transdifferenz als in diesem Fall literarisches Phänomen, das sich mit Grenzen, Polen und dem Raum des Dazwischen auseinandersetzt.“
Ihre eigentliche Stärke hat die Studie dort, wo sich die Verfasserin auf die Analyse der genannten Romane konzentriert (ca. ein Drittel der Arbeit) und sich zum Teil deutlich von vorgefundenen Forschungsergebnissen distanziert, etwa in der Deutung des Schlusses von Godbouts Salut Galarneau!, der alles andere als eindeutig für eine Rückkehr des Protagonisten in die gesellschaftliche Normalität aufgefasst wird, oder in der Infragestellung der behaupteten Geschlossenheit von Fritschs Roman Fasching, der sich vielmehr durch häufigen, das Nicht-Finden von Identität anzeigenden Perspektivewechsel auszeichnet, oder im Zweifel daran, Sascha Graffito in Schindels Gebürtig als auktorialen Erzähler eines Handlungsstrangs anzusehen, was im deutlichen Widerspruch zur Thematisierung der Unmöglichkeit von eindeutigen Festlegungen steht.
Für Felix Golub hat, übertragbar auf Österreich, die Negation von Identität mit der nicht aufgearbeiteten Vergangenheit zu tun. Überraschend aber, dass nicht nur die österreichische Gesellschaft der 1960er Jahre, in der die ewiggestrigen alten Nazis das Sagen haben, integrationshemmend wirkt, sondern auch die moderne amerikanische. So ist die Erzählerfigur hier wie dort ein- und ausgeschlossen. In beiden Romanen prägen „Erzählung als Grenze und die Ambivalenz aus geschlossenem und offenem Erzählraum […] die Erzählsituation“ in ähnlicher Weise. Fritsch lässt Felix Golub, ein- und ausgeschlossen in seiner Grube, von einem Ort der Erinnerung her erzählen, vergleichbar übrigens anderen österreichischen Autoren und Autorinnen, die in ihren Texten um das Thema Heimat/Anti-Heimat kreisen. Interessant wäre es im Hinblick auf persönliche ebenso wie staatliche Identitätsfindung aber auch, den Blick über Österreich hinaus auf Werke deutscher Autoren zu werfen, die – wie Günter Grass in der Blechtrommel oder Siegfried Lenz in der Deutschstunde – ebenfalls von einem ver-rückten Ort aus erzählen lassen. Dann ließe sich vielleicht die Frage beantworten, ob die Unmöglichkeit von Utopie, die Dominanz von „Tod, Verstummen und Finsternis“ nur „das Leben in der österreichischen Nachkriegsgesellschaft der 60er Jahre“ bestimmen oder nicht auch in der bundesdeutschen, beziehungsweise worin die Unterschiede bestehen. Wie auch immer, an Gerhard Fritschs Fasching lässt sich im Vergleich zu seinem Romanerstling Moos auf den Steinen (1956) ein Paradigmenwechsel in der österreichischen Literatur beobachten von der austriakischen beziehungsweise volkstümelnden Rückwärtsgewandtheit und traditionellen Erzählweisen, die nach 1945 und bis in die frühen sechziger Jahre den offiziellen Kulturbetrieb dominiert haben, zur Auseinandersetzung mit der jüngsten Vergangenheit, mit dem Fortwirken des Faschismus etc. und neuen Erzählverfahren. Der Stellenwert von Fasching innerhalb der Geschichte der österreichischen Literatur nach 1945 ist daher kaum zu überschätzen, wurde allerdings auch nicht erst, wie Gruber insinuiert, mit der Neuauflage des Romans von 1995 und dem Nachwort von Robert Menasse in seiner Bedeutung erkannt, sondern u. a. schon von Albert Berger in einem durchaus richtungweisenden Aufsatz von 1979 (der in der vorliegenden Studie unberücksichtigt bleibt).
„Und was ich bin, ist mir fremd“ – diese Aussage der Jüdin Mascha Singer in Schindels Gebürtig charakterisiert nicht nur die Identitätsproblematik der über dreißig Personen, speziell der jüdischen in diesem Roman, sondern auch der drei Frauen in Robins La Québécoite. Für beide Texte gelten: Vielstimmigkeit, Heterogenität, Deterritorialiserung, Ortlosigkeit, fehlende Verwurzelung, Nicht- beziehungsweise Mehrfachzugehörigkeiten, Erinnerungsstörungen, Problematik des kollektiven wie individuellen Gedächtnisses, nomadisierendes Erzählen, Fehlen sprachlicher Eindeutigkeiten, Unmöglichkeit authentischer Darstellung, vor allem der Greueltaten der Nazis. Schindels Roman bestätigt den Befund der österreichischen Literatur seit den 1960er Jahren, gewissermaßen von Hans Leberts Wolfshaut (1960) und Fritschs Fasching bis Elfriede Jelineks Kinder der Toten oder Christoph Ransmayrs Morbus Kitahara (beide 1995), dass nämlich die österreichische Provinz aufgrund der Nicht-Auseinandersetzung mit der Nazi-Vergangenheit und des Weiterwirkens faschistischen Bewusstseins ein unmöglicher Lebensraum ist. Allerdings beobachtet Gruber von den 1960er zu den 1980er Jahren einen Rückgang des Themas (Anti-)Heimat – was nicht ganz so eindeutig erscheint – aber auch des Interesses an Fragen nationaler Identität, die zunehmend hinterfragt wird – für Österreich jedenfalls durchaus zutreffend. Dies zeigt sich eben in grundlegenden Veränderungen der „Raumnarration“ und der „Narrationsräume“, man könnte es verkürzt so sagen: vom Eingeschlossensein zum Nomadisieren.