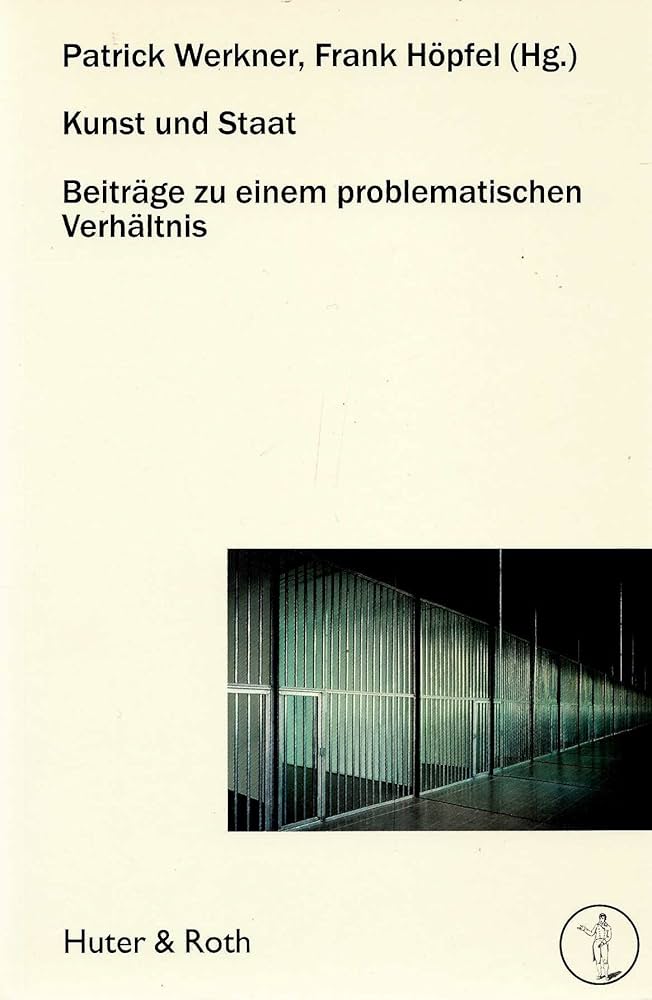Wer macht sich hier Gedanken: 2 Frauen und 10 Männer. Wann macht man sich darüber Gedanken: wenn man tief eingetaucht ist in die enge Verwobenheit, wenn man also in vielfältiger Weise Erfahrungen gemacht hat. Wann hat man die gemacht: wenn man vom Staat beauftragt, begünstigt, ausgewählt wurde. Einige der Autoren sind dieser Gruppe zuzuzählen: Manfred Wagner, lange Jahre Professor an der Universität für angewandte Kunst, als Herausgeber einer Geschichte Niederösterreichs eng mit der niederösterreichischen Landesregierung in Zusammenarbeit, Kurator, Kommissionsmitglied und Vorsitzender von staatlich finanzierten Kunst-fördernden Institutionen; oder Gerald Bast, Gastgeber der Reihe und Verfasser eines Vorwortes, der in seiner beruflichen Karriere vom Ministerialbeamten zum Kunstuni-Rektor das Gegensatzpaar glücklich vereint.
Es werden keine etymologisch-historischen Begriffsklärungen gegeben, jeder und jeder der Beschreibenden klärt sie neu, und so stellt es sich dar, als ob Kunst und Staat einander schon zur Begriffsdefinition, ja beinahe zur Konstitution ihrer selbst brauchen. Manfred Wagner definiert den Staatsbeginn ungefähr bei Maria Theresia, zugleich mit dem ersten Subventionsansuchen eines Künstlers, Leon Botstein klärt den Begriff und Status des Künstlers. Und so recht er hat, dass sich seine Ausführungen fast ausschließlich auf den männlichen Künstler beziehen, kann es doch nicht sein, dass die Künstlerinnen in einer Publikation des Jahres 2007 kaum erwähnt, ich vermeide zu sagen, behandelt werden. Die weite Spanne des Begriffes „Staat“ auch auf Hitlers Reich auszudehnen, rechtfertigt sich nur in der Tatsache, die Birgit Schwarz ausführt: „Hitlers Museumspolitik und ihre Auswirkungen bis heute“, letztlich eine deprimierende Rechts- und Personenkontinuität in der österreichischen Museumspolitik. Die Begriffsklärung des Titel-Paares als Ausgangspunkt der Zugänge zu wählen ist legitim, manchmal sogar erhellend-poetisch wie bei Ernst Strouhal, ein Versäumnis ist es aber, andere ungeklärte Begriffe einfach unkritisch zu übernehmen, etwa Leon Botsteins „bürgerliche Erwartungen“.
Wie sie einander brauchen, Kunst und Staat, behindern sie einander auch. Sie werden sich ihrer angeblichen Autonomie bewusst, wenn sie einander existenziell fehlen oder befehden. Fast jeder der Beiträge beginnt bei einem Konflikt der beiden machtvollen Geschwister: An Werner Schröters „Liebeskonzil“, einem Film, der 1985 in Innsbruck beschlagnahmt und verboten wurde, formuliert sich der Mangel eines gesamteuropäischen Standards für die Kunstfreiheit.
Wie sehr die beiden verschwistert sind, zeigt sich an den Staatsfeiertagsfeiern oder Inaugurationen: Gerade der Film „Liebeskonzil“ wurde am Staatsfeiertag 2005 Studierenden der Wiener Universität gezeigt; die Biographie Otto M. Zykans, der nicht nur in der „Staatsoperette“ als Angreifer bestehender Werte gesehen wurde, verzeichnet besonders viele Auftritte an Staatsfeiertagen. Der Staat schmückt sich gern mit denen, die sich ihm entziehen, wenns ihm auch bequemer ist, mit jenen die sich anbiedern umzugehen. Aber das schreit schon nach einer Fortsetzung.
Der Band ist lesbar und handlich, thematisch klug eingegrenzt, ein Register hätte ich mir allemal gewünscht.