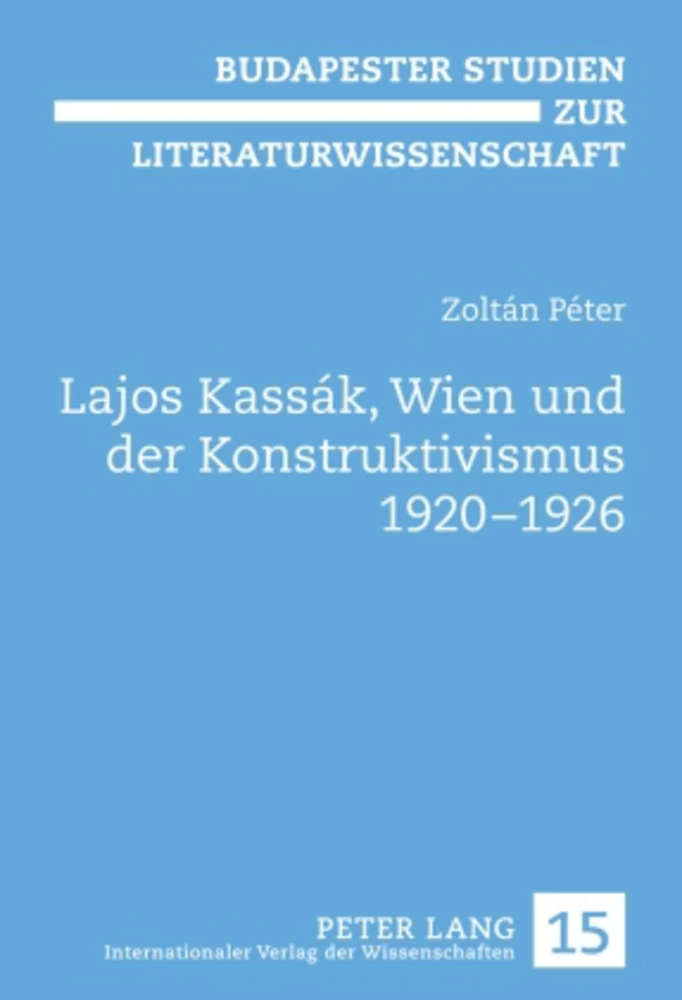Dagegen hat die Avantgarde in der jungen Republik nach 1918 eher wenige Spuren hinterlassen – kein Dadaismus wie in Zürich, Paris oder Berlin, kein Surrealismus in Wien, kein Manifestantismus wie in Italien bei den Futuristen oder andere spektakuläre Ismen oder Gruppierungen wie in den anderen Ländern. Diese frühe avantgardistische Abstinenz ist sicher nicht einfach zu erklären, da spielen viele Faktoren eine Rolle – vom Einfluss des anti-avantgardistischen Karl Kraus, der Expressionismus und Aktivismus demolierte, bis zur anhaltenden kulturellen Macht der k.u.k-Tradition. Jedenfalls ist in der Avantgarde-Forschung zugespitzt sogar vom „Fehlen einer eigenen Avantgarde“ (S. 116) in Österreich überhaupt gesprochen worden.
Was aber an früher, historischer Avantgarde in Österreich existiert hat, sind neben kleineren, weniger spektakulären Aktivitäten vor allem der (notabene sehr gut erforschte) österreichische Expressionismus, der Aktivismus in der Person Robert Müllers (ein absoluter Außenseiter) und der erst in allerjüngster Zeit wiederentdeckte Kinetismus (als ganz eigenständiger Ismus und insofern ein außerordentlich origineller Beitrag Österreichs zum Ensemble der avantgardistischen Ismen). Zudem wäre auf den Wiener Konstruktivisten Friedrich Kiesler zu verweisen oder auf avantgardistische Tendenzen in der Architektur des Roten Wien wie in der Werkbundsiedlung.
Wenn Österreich also während der 1920er Jahre keine prominente Avantgarde hervorgebracht hat, so war sie dennoch ein ganz besonderer Schauplatz avantgardistischer Aktivitäten, und hierüber handelt das Buch von Zoltán Péter über Lajos Kassák, Wien und den Konstruktivismus der Jahre 1920 bis 1926. Diese (in sehr sprödem Wissenschaftsdeutsch geschriebene) Wiener Dissertation von 2009 untersucht nicht die Spuren der österreichischen Avantgarde selbst, sondern die aus Ungarn exilierte Avantgarde auf österreichischem Boden, es geht also um eine quasi ‚fremde‘, ausländische Avantgarde auf Wiener Boden. Und in der Tat besaß die ungarische Exil-Avantgarde mit Lajos Kassák eine Leitfigur, die es in ihrer Funktion als Organisator und Motor der ungarischen Avantgarde gewiss mit André Breton im französischen Surrealismus oder Karel Teige im tschechischen Poetismus aufnehmen konnte.
Der Schriftsteller und Maler Kassák, Jahrgang 1887, der in jungen Jahren in Paris Kontakte zu der dortigen frühen Avantgarde um Apollinaire, Cendrars und Picasso knüpfte, war bereits vor der Ersten Weltkrieg Gründungsfigur des ungarischen Expressionismus, seit 1916 gab er die Zeitschrift „Ma“ („Heute“) heraus, die er später zum Sammelbecken der internationalen Avantgarde auf- und ausbauen sollte, zunächst des Aktivismus, dann des Konstruktivismus. Nach der Zerschlagung der Räterepublik in Ungarn 1919 emigrierte Kassák mit seiner Zeitschrift nach Wien, wo er bis zur Rückkehr nach Budapest 1926 blieb. Kassák, der 1967 in Budapest starb, gilt heute zu Recht als einer der bedeutendsten Vertreter der europäischen Avantgarde.
Kassák nahm also seine Zeitschrift mit ins Wiener Exil und machte sie seit ihrem Erscheinen in Österreich 1920 zu einem wichtigen transnationalen Periodikum der europäischen Avantgarde, mit der sie eng vernetzt war – die Spanne der in „Ma“ publizierenden Avantgardisten reicht von Kurt Schwitters bis Theo van Doesburg, von Ivan Goll bis László Moholy-Nagy. Die Arbeit beschreibt zunächst die Entwicklung des Autors bis 1919, wobei methodisch Bourdieus Theorie des literarischen Feldes und des Habitus zu Grunde gelegt wird. Dergestalt wird sodann das „Feld“ des Wiener Exils untersucht; es folgen ausgewählte Analysen seiner künstlerischen und literarischen Werke und Manifeste, darunter findet sich auch eine umfängliche Untersuchung von Kassáks wichtigem Poem Das Pferd stirbt und die Vögel fliegen aus. Abschließend wird Kassáks Entwicklung seit seiner Rückkehr nach Ungarn skizziert.
So wird deutlich, dass Wien zwar Erscheinungsort eines ganz exponierten Avantgarde-Organs war, ohne aber über eine eigene Avantgarde zu verfügen. Denn, wie die vorliegende Arbeit zeigt, die „Ma“-Aktivitäten von Lajos Kassák blieben eher isoliert, trotz der internationalen Ausstrahlung seines Konstruktivismus. Dabei problematisiert der Autor die Wiener Sonderrolle in Sachen Avantgarde durchaus, auch mit Blick auf das Wirken von Karl Kraus (S. 110ff.), und er bemüht sich zudem, Berührungspunkte zwischen „Ma“ und der Wiener Szene aufzuspüren. Ein Beispiel: Die Zeitschrift führte in Wien sog. „Ma“-Abende durch, an deren Gestaltung und Präsentation eine relativ große Anzahl von deutschsprachigen Künstlern mitgewirkt haben. Es sind überwiegend unbekannte Namen, aber dennoch sei „die Aufmerksamkeit einiger Wiener Zeitungen“ geweckt worden (S. 135). Leider wird dieser Spur nicht weiter nachgegangen – dabei wäre dies doch aufregend genug zu sehen, wie man in Wien auf die avantgardistische Emigration reagiert hat – wie ausführlich oder spärlich diese Reaktionen auch gewesen sein mögen.
Ein weiterer Berührungspunkt mit Österreich hat sich historisch aus dem Pressegesetz ergeben, das für fremdsprachige Zeitschriften einen offiziellen österreichischen Redakteur vorsah. Bei der Untersuchung der Positionen dieser „Wiener Mitwirkenden“ (S. 137ff.). Es waren dies Fritz Brügel, Josef Kalmer, Herman Suske und Hans Suschny, außer Brügel und vielleicht noch Kalmer also wenig oder ganz nicht mehr bekannte Autoren. Auch weitere Wiener „Ma“-Mitarbeiter werden vorgestellt – der Expressionist Jakob Levy Moreno und der avantgardistische Musiker Josef Matthias Hauer. Allerdings zeitigte auch hier der Kontakt zwischen ungarischer und österreichischer Avantgarde kaum tiefere Spuren. „Es gab“, so ein Resümee, „keinen anhaltenden literarischen Einfluss seitens der Wiener Avantgardisten auf den Ma-Kreis und umgekehrt.“ (S. 142) Das merkwürdige Faktum, dass (nach jetzigem Wissensstand) kein Zeugnis darüber existiert, dass sich Lajos Kassák um avantgardistische Kaliber wie Robert Müller und Friedrich Kiesler bemüht hätte oder diese ihm oder er ihnen über den Weg gelaufen wäre, bestärkt diesen Eindruck. So erscheint die österreichische Avantgarde als eher kleines „Laboratorium inmitten des internationalen Avantgarderaumes“, das in Wien agierende Feld der ungarischen Avantgardisten aber wiederum als „Labor im Labor“ (S. 15).