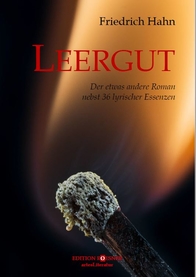Umso mehr erfreut es, dass Friedrich Hahn es wagt – und dabei alles gewinnt. Leergut nennt sich sein neues Buch- und was hier fehlt, wird schon bald klar: das Thema. Doch damit nicht genug: auch Haupt- und Nebenfiguren sind in dem Text nicht zu finden. Seltsam, dass so eine Art des Schreibens in unserer Zeit der Post-Post-Moderne immer noch als „waghalsig“ gilt! Dabei gibt es viele Dichter, die Romane ohne jegliche Sujets schreiben wollten und es auch getan haben: Während schon Gustave Flaubert den Begriff „Sujet“ nahezu verachtete, so sah die Schriftstellerin Adelheid Duvanel, geboren in der Schweiz, es als ein Ideal an, Erzählungen vom Ballast ihrer Haupt- und Nebenfiguren zu befreien – und Samuel Becketts letzte Texte tragen auch den klingenden Titel „Texte um nichts.“ Mit diesen eben genanntem Arbeiten scheint sich Friedrich Hahn durchaus befasst zu haben. Wen wundert es, dass dem Buch Leergut demnach auch ein Zitat einer der Vorreiterinnen des sprach-affinen Erzählens voran gestellt wird – nämlich eines von Gertrude Stein? „Ich frage mich ob jeder etwas Interessantes ist indem er einer ist der am Leben ist. Ich frage mich das“, lesen wir, wenn wir die erste Seite des eben erschienenen Buches aufschlagen – und sind sofort neugierig.
Leergut also. Zwar hat der Text kein eindeutiges Thema – dafür geht es auf der Ebene der Sprachbehandlung umso fokussierter zu: Zitate aus der Literatur, lyrische Einsprengsel, gesellschaftskritische Kommentare, aber auch philosophische Fragen wie in etwa: „Was ist von Zimmerpflanzen zu halten, die nicht mich meinen?“ wechseln einander ab, beleuchten auf verschieden Arten das Gefühl des Fremdseins in einer überbordenden und mediendominierten Wirklichkeit. Wichtige Orientierungsmomente in diesem sprachlich so klar und gekonnt dahinfließenden und ganz und gar unprätentiös geschriebenen Buch sind zweifellos die Kapitelüberschriften. Sie würzen den Text mit Humor – „Hallo Welt, hätte da mal eine Frage“ –, bieten Momente zum Schmunzeln oder kommentieren ohne jegliches Pathos, was im nächsten Abschnitt abgehandelt werden soll – man denke hier nur an die Überschrift „Hören und Sehen vergeht“. Doch nicht nur gliedern diese „Headlines“ die Abschnitte in „verdaubare Häppchen“, sie kehren auch in variierter Form wieder: So heißt beispielsweise eine spätere Episode, auf „Hören und Sehen“ rekurrierend, „Hören und sehen“ – und/oder sie enthalten in sich selbst Sprachspiele und können fast als eigene für sich stehende Kürzestgedichte interpretiert werden. Manche von diesen so liebevoll gestalteten Überschriften enthalten auch Zeitangaben – wie etwa „30 Sekunden davor“ – oder Namen („Onkel Dreifuß“).
Was die Form betrifft, so wird der Autor im Laufe des Buches radikaler – und das nach einem dramaturgischen Prinzip. Ab Seite 96 entsteht ein harter Bruch in der Textform – und nun darf das lyrische Ich zu Wort kommen. Aber der Neubeginn ist nur ein scheinbarer: Die Überschriften, die uns nun vor den jeweiligen Gedichten begegnen, sind zum Teil aus den Prosa-Abschnitten entnommen und spiegeln deren literarische Färbung auf verknappte Art und Weise wieder. Fast listenartig wiederholt sich hier, was dem Ich-Erzähler in der Prosa widerfahren ist: Kühlschränke röcheln, Bäume werden um ihre Standhaftigkeit und Ruhe beneidet, und die Idee „Das hatten wir doch schon“ drängt sich spätestens auf Seite 108 bei dem gleichnamigen Gedicht auf.
Ja: die beiden Textformen der zwei Buchteile spiegeln einander! „Die Gedichte sind Destillate der Prosa“, gibt Friedrich Hahn auch im Gespräch zu. „Ein Aspekt, der mich schon lange interessiert: Wo hört Lyrik auf, wo beginnt Prosa – und umgekehrt.“ Da die Prosa von Leergut dem Schreibenden Zeile für Zeile immer poetischer vorkam, so lag es für ihn nahe, sie weiter zu verknappen, daraus Gedichte zu formen.
Liest man Leergut, so ist bald klar: Das Leben scheint eine Art Hochschaubahn zu sein, in der man die Orientierung verliert, Oben von Unten, Lyrik von Prosa, Innen von Außen, Damals von Heute und Traum von Wirklichkeit nicht klar trennen kann, denn der einzige Unterschied, den es zwischen den Dingen gibt, ist durch Sprache gemacht – und die verschiedenen Ebenen des Lebens sind ineinander verklammert wie verfilzte Haare. Wen wundert es, dass die Hochschaubahn auch am Anfang des Textes auftaucht – und das absolut nicht als Metapher, sondern als real gemeinter Ort? „Am Eingang zur Hochschaubahn steht ein Gartenzwerg. Und es bewahrheitet sich wieder einmal: In einer Situation ist man nicht genug Kind. In einer anderen nicht genug Erwachsener. Das Innere verworren. Das Äußere übermächtig. Und am Ende bleibt immer jemand traurig zurück“, heißt es so auch schon zu Beginn des Buches – und dieses Gefühl bleibt bis zum Ende des Buches bestehen.
Aber das macht nichts, denn immerhin steht eines fest: die Welt ist voller Träume, Ideen und Möglichkeiten – auch, wenn am Ende nichts bleibt als die Erkenntnis: „So könnte es gewesen sein.“ Ein Buch voll dichter Spracharbeit, voll von prallen Sätzen, humorvoll und philosophisch zugleich.