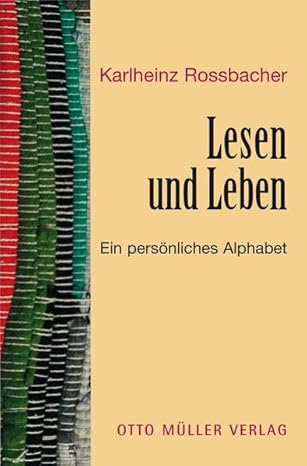Dabei eröffnet sich ein beeindruckender Lesehorizont weit über die deutschsprachige Literatur hinaus, denn Rossbacher hat auch Anglistik studiert und war zuerst Stipendiat und später Gastprofessor in den USA; aber auch aus dem Werk des französischen Schriftstellers Alain vermag er faszinierende Funken zu schlagen. Von ihm hat er gelernt, „schöne Sätze im Ohr noch aufmerksamer zu betreuen und zu konservieren“, und gerade diese Fähigkeit kultiviert auch sein eigenes Buch. Aus der Literatur entliehene Sätze können aus der Unschlüssigkeit im eigenen Denken heraushelfen und einem einen Spiegel leihen, in dem man sich anders sieht, so Rossbachers Erfahrung.
Doch das Buch lebt nicht nur aus dieser Belesenheit, die man von einem „Literaturprofi“ ohnedies erwartet. Zu seiner Hochform läuft es auf, wenn Rossbacher seine vaterlose Nachkriegskindheit oder die Angst vor einer möglicherweise nötigen Operation mit literarischen Szenen und Sätzen verknüpft und so seine Erzählung immunisiert gegen das „bunte Gerede des Anerlebten“ (Paul Celan). Dabei bringt er das Kunststück fertig, Ludwig Anzengrubers Satz „Es kann dir nix g’schehn!“ (ausgesprochen vom Steinklopferhans im Drama Die Kreuzelschreiber) auf die eigene Lebenssituation zu beziehen und gleichzeitig die Rezeption dieses Zentralsatzes eines gläubigen Disseitsvertrauens in der österreichischen Literatur zu verfolgen.
Rossbacher ist der Versuchung widerstanden, durch Chronologie in das eigene Leben nachträglich eine Folgerichtigkeit hineinzuinterpretieren oder irgendeine „Ordnung“ literarischer Epochen oder Werke walten zu lassen. Gegen das konstitutive Chaos der Erinnerung setzt er das Prinzip des Alphabets, ohne ihr damit Gewalt anzutun, denn wenn es sein muss, generiert ein Buchstabe eben zwei Essays – erstaunlich, was er Wörtern wie „Rauchen“ und „Raunzen“ abzugewinnen vermag, wie er auch hier eigene Erfahrung und kulturelle Diagnosen zu verbinden weiß. Liest man vom Vormärz, „als es in Wien politisch gärte und die Regierung Metternich die Wein- und Backhendlpreise absenkte, um die Leute ruhigzustellen“, sieht man auch die heutigen österreichischen Essgewohnheiten anders.
Mit Trinkgewohnheiten setzt sich Rossbachers Alphabet ebenfalls auseinander – unter dem Stichwort „Alkohol“ reflektiert er gleichermaßen über sich selbst wie über die Trinkpraxis von Autorinnen und Autoren. Ob Film, Kitsch, Krimi oder Langsamkeit: Rossbachers literatur- und theoriegestützte Diagnosen sind präzise und von jener analytischen Schärfe, die der Literatur neben ihrer ästhetischen Dimension auch eigen ist. Besondere Intensität erreichen diese Essays allerdings dort, wo sich Rossbacher ganz auf das Eigene, auf selbst durchlebte Szenen einlässt. Wie er als bereits etablierter sechzigjähriger Wissenschaftler Angst verspürt, weil er im Goldenen Saal des Musikvereins den ersten Plenarvortrag auf dem Weltkongress der Internationalen Vereinigung für Germanistik halten soll, und dann allein diesen Saal aufsucht, um sich mit ihm (und seiner Angst) vertraut zu machen, ist eine der unvergesslichen Passagen des Buches. Ein Zitat von Bertrand Russel macht sie zum Wegweiser aus eigenen Ängsten: „Jede Art von Angst wird aber dadurch, daß man ihr ausweicht, nur noch schlimmer. […] Darum besteht die richtige Behandlung jeder Angst darin, daß man vernünftig und ruhig, aber sehr konzentriert so lange darüber nachdenkt, bis sie einem völlig vertraut geworden ist.“
Erfahrungen mit dem Nein-Sagen oder das Leben mit Tinnitus sind weitere Schnittpunkte, die den präzisen Titel Lesen und Leben konkretisieren. An wenigen Stellen des Buches sind auch Porträts eingebaut; das berührendste ist das von Mia Blagotinšek, die der Autor als sechzehnjährige Haushaltshilfe in seiner Kärntner Herkunftsfamilie kennen gelernt hat und mit der er auch heute – sie lebt als alte und kaum noch sprechfähige Frau in Slowenien – einen gerade noch möglichen Kontakt hält. Als Jugendliche musste sie nachts hinaus, um die Partisanen zu unterstützen, während sie am Tag bei der Familie arbeitete, die ein Attentat ebendieser Partisanen auf das Schulhaus durch einen Glücksfall überlebt hatte. Diese Geschichte ist eine der Schneisen, die Rossbacher in die jüngste Vergangenheit Österreichs legt.
Ein Gegenpart dazu sind die USA-Erfahrungen des akademischen Jahres 1963/64, denen eine heute schon exotische Fahrt mit dem Linienschiff vorausging. Einer der Vorzüge von Rossbachers Buch ist, dass es die Welt ebenso im Blick hat wie das eigene Leben und die Literatur. Auf bestechende Weise wird das unter dem Stichwort „Bani-Sadr“ deutlich, wo Büchners Dantons Tod im Jahr 1981 zum Interpretationsschlüssel für die iranische Revolution und ihren ersten Staatspräsidenten wird – was für ein stringenter Erweis der Relevanz Büchners zu seinem 200. Geburtstag!
Sensibilisiert durch die Sätze der Literatur haken Rossbachers Essays immer wieder an der Sprache ein. So entlockt ihm etwa der Werbeslogan „Südtiroler Speck, das Ergebnis besonderer Zuwendung“ die Frage: „Ist das Wort jetzt noch schadstofffrei?“ Und der genaue Blick auf die Wörter und Sätze weitet sich zur präzisen Diagnose von Medien und Markt, etwa in der Kritik des Empfindungsjournalismus („Was haben Sie dabei empfunden?“) und seiner Intimneugier. Immer wieder stößt man auf Unerwartetes, Überraschendes oder auf neue Perspektiven von Sätzen und Werken, die man bereits zu kennen glaubte. Rossbachers Lesen und Leben ist ein hervorragendes Präzisionsinstrument für die eigene Lektüre und versteht es, die Lust des Lesers/der Leserin an der Erkenntnis der Welt und des eigenen Lebens in Gang zu halten.