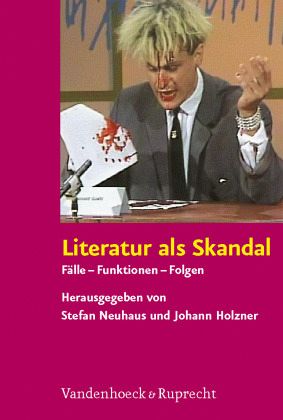Der Ziegelcharakter macht das Buch zwar für eine Bettlektüre aus Format- und Gewichtsgründen ungeeignet, aber dafür ist es zweifellos ein fundamentaler Baustein zum Thema. „Der vorliegende Band möchte, auf der bisherigen Forschung aufbauend, die Zahl der Einzelstudien erweitern und diese zugleich bündeln, um wenn schon nicht eine Gesamtdarstellung, so doch eine umfassende Auswahl mit Handbuchcharakter präsentieren zu können.“ (S. 12) So formulieren die Herausgeber im Vorwort, und das ist auch aufs schönste gelungen. Der erste, schmälere Abschnitt widmet sich der „Theorie des Skandals“, und hier sind es u. a. der Systematisierungsversuch von Claudia Dürr / Tasos Zembylas sowie die fundierte Analyse von Marc Reichwein zur „Literaturvermittlung als zunehmende Inszenierung von Paratexten“, die man auf keinen Fall versäumen sollte.
Der Hauptteil des Bandes aber ist der „Praxis des Skandals“ gewidmet, also den Einzelfällen, deren Bandbreite enorm ist und dabei werden keineswegs nur alle klassischen Fälle neu aufgerollt. Natürlich fehlt Thomas Bernhard nicht, präsent ist er allerdings nicht mit „Heldenplatz'“, sondern mit zwei Beiträgen zu „Holzfällen“ (Joseph W. Moser, Christiane Böhler, die den Verlust der Skandalträchtigkeit im verflachenden Übersetzungsprozess ins Italienische nachzeichnet). Zum Thema „Holzfällen“ wäre übrigens die vergleichende Lektüre der Lebensgeschichte der Joana bei Thomas Bernhard und Jeannie Ebner ein Desiderat. Peter Turrini, einem geübten Skandalisierungsfachmann, wie Antonio Fian in einem seiner Dramolette unterstellt, wird nur dort und da erwähnt, ebenso Urs Allemanns „Babyficker“, der Aufreger von 1991. Von Elfriede Jelinek wird das Medienereignis rund um „Raststätte“ (Artur Pelka) untersucht und in einem sehr sensiblen Aufsatz von Sieglinde Klettenhammer werden die Romane „Die Klavierspielerin“ und „Lust“ in die Pornographiedebatten des ausgehenden 20. Jahrhunderts eingebettet. Benjamin Wilkomirski sind ebenfalls zwei Beiträge gewidment (Martin A. Hainz, Sabine Kyora), Conny Hannes Meyer wird nur erwähnt.
Abgesehen von diesen „notorisch“ bekannten Fällen bietet der Band eine enorme Fülle an Fallgeschichten aus unterschiedlichen Epochen. Gottfried von Straßburgs „Tristan“ (Waltraud Fritsch-Rößler) kommt ebenso vor wie der Konflikt Heinrich Heine / August von Platen (Ruth Esterhammer, Claude D. Conter), Choderlos de Laclos‘ „Gefährliche Liebschaften“ (Gerhild Fuchs) oder Oskar Panizzas „Liebeskonzil“ (Helga Mitterbauer), Arnolt Bronnen (Lars Koch) oder Klaus Mann (Osman Durrani), Vladimir Nabokovs „Lolita“ (Markus Gasser) oder die Serbien-Debatte rund um Peter Handke (Susanne Düwell). Eine Reihe von Beiträgen beschäftigt sich zwangsweise mit der Frage der brüchig gewordenen Grenze zwischen Realität und Fiktion, die – wie schon „Holzfällen“ – Literatur immer häufiger zu einem Gegenstand der Gerichtsberichterstattung werden lässt. Das trifft auf Maxim Billers „Esra“ (Bettina von Jagow, Martin Hielscher) ebenso zu wie auf die Frage der (In)Diskretionen und biografistischen Lektüren am Beispiel von Max Frisch (Celine Letawe) und Ingeborg Bachmann; die jüngste Affäre um ihren nachgelassenen Gedichtband „Ich weiß keine bessere Welt“ zeichnet Hubert Lengauer mit feiner Klinge nach.
Eingestreut sind auch einige Blicke ins fremdsprachige Ausland, auf die Literaturverbote in den USA (Helmut F. Pfanner) oder einen bemerkenswerten Theaterskandal in Irland (Regina Standun). Wünschenswert wäre hier eine forciertere fächerübergreifende Kooperation mit Anglisten, Romanisten etc., um nach Differenzen und Analogien in der Genese und im Umgang mit Literaturskandalen zu fragen. Doch nicht weniger spannend sind im vorliegenden Band die beiden Heimspiele von Barbara Hoiß / Sandra Unterweger und Christine Riccabona, die den Konflikten zwischen Literatur und Kunst und den Tiroler „Ordnungshütern der Heimat und des Glaubens“ in der ersten und zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nachgehen. Während Andrea Gnam die „verstörenden Gesten“ in der Literatur der 1960er Jahre bei Peter Handke, Ernst Weiss oder Gisela Elsner aufzeigt, ist die Provokation der sprachartistischen Avantgarde der 50er Jahre nicht vertreten. Das hat einen guten Grund, diese Debatten und Verstörungen sind andernorts schon vielfach aufgearbeitet. Dasselbe gilt wohl auch für den „Reigen“-Skandal, der thematisch gewissermaßen mit einem Beitrag zu Hermann Bangs Roman „Hoffnungslose Geschlechter“ (Claudia Gremler) präsent ist. Piet Defraeye liefert eine kleine Geschichte der Theaterprovokation, und Wolfgang Pöckl fragt nach den öffentlichen Entrüstungen über modernisierende Übersetzungen, die er am Beispiel von Hans Magnus Enzensberges Moliere-Übertragung darstellt. Nicht weniger Debatten hat auch die „erste moderne Gesamtübersetzung“ von Montaignes „Essais“ durch Hans Stilett im Eichborn Verlag hervorgerufen, wobei die Vorzugsausgabe dieser Edition vor allem deshalb stillos war, weil sie Montaignes leichtfüssige „Essais“ in eine mit Goldprägung versehene Hausbibel-Verkleidung zwang. Spannend wäre im übrigen auch einmal eine Geschichte der ausgebliebenen bzw. übersehenen Skandalisierungen, am Beispiel von Goethes „Wilhelm Meister“ etwa, der mit unglaublich offener Derbheit und Frivolität von „Reigen“-artig rasch wechselnden erotischen Begegnungen erzählt, samt den Folgekosten wie Duellen und Geschlechtskrankheiten – was die Zeitgenossen wohl gelesen haben, die jahrhundertelangen Germanistenlektüren dann aber im Dienste des klassischen Bildungsromans geflissentlich übersahen.
Im vorliegenden Band versucht Alexander Ritter am Beispiel von Alfred Andersch etwas hämisch eine „Skandalinszenierung ohne Skandalfolge“ aufzuzeigen, da die Debatte auf ein enges Fachpublikum beschränkt geblieben sei. Doch die Argumentation will nicht ganz überzeugen, der Verlust an moralischem Gewicht, den Andersch – wie auch Günter Grass oder Martin Walser (dazu Michael Braun, Christoph Hägele) – durch die zu späte Enthüllung über persönliche NS-Verstrickungen erlitten haben, wird die Relektüre ihrer Werke lenken und prägen. Als Günter Grass‘ „Treffen in Telgte“ 1979 erschien, war er als Symbolfigur des aufrechten Mahners zu Offenheit im Umgang mit der NS-Vergangenheit so stark, dass damals offenbar niemand gelesen hat, was heute keinem mehr verborgen bleiben kann: Die unhaltbare Schräglage der Schuldmetaphern-Analogie zwischen Faschismus und 30jährigem Krieg , die die religiös verorteten Kriegsparteien von damals mit den „Kampfparteien“ Faschisten und Antifaschisten überblendet.
Als Exemplum von staatstragender Bedeutung rollt Doris Moser den Fall „Austrokoffer“ neu auf und zeichnet die Ereignisse mit ironischer Distanz nach; nur sehr dezent weist sie dabei auf das Eigeninteresse jener AutorInnen hin, die sich nachträglich zu Mitherausgebern machen ließen und dafür sehr „prominent vertreten“ (S. 702) sind. Da das Kofferprojekt die angepeilte Funktion eines repräsentativen Querschnitts durch die österreichische Literatur aber weit genug verfehlte, war der Gewinn nicht sehr groß.
Ein großer Gewinn aber ist der vorliegende Band, prall voll mit anregenden und spannenden Analysen. Dass bei dieser Fülle an durchgängig sorgfältig gearbeiteten Einzelbeiträgen allenfalls einer im etwas hohl Plaudernden verbleibt und ein anderer unfreiwillig ins offen Abstruse kippt, ist tatsächlich nicht der Rede wert. Wer in Zukunft zu diesem Thema arbeitet, kann an diesem Baustein zu Literatur als Skandal jedenfalls nicht vorübergehen. Dass sich im Anhang ein sorgfältiges Register der Autorennamen und der behandelten Werke findet, macht das Buch auch zu einem brauchbaren Nachschlagwerk.