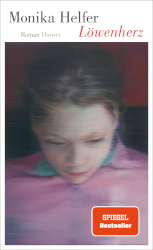Nach dem Tod der Mutter wachsen Monika Helfer und ihre beiden Schwestern getrennt vom kleinen Bruder auf. Sie sehen einander selten, Richard lebt bei einer Tante in Feldkirch, die Mädchen in Bregenz. Richard wird von Beruf Schriftsetzer und ist stolz darauf, zur „Avantgarde der Arbeiterklasse“ zu zählen. Er liest viel und malt leidenschaftlich, aber er ist ein Sonderling, ein Einzelgänger. Wichtige Begegnungen und Gespräche spielt er szenisch nach, um sie zu verstehen – Monika hilft ihm dabei. Verantwortung übernimmt er nur, wenn sie ihm angetragen wird, etwa als eine Zufallsbekanntschaft ihr Kind, von dem er nur den Spitznamen kennt, bei ihm „unterstellt“. Die unfreiwillige Vaterrolle wird zum großen Glück für den jungen Mann, zumindest für einige Zeit. Als Leser/in folgt man der fast märchenhaft anmutenden Geschichte von Richard, seiner Ziehtochter Putzi und dem Hund Schamasch mit ungläubigem Staunen und klopfendem Herzen, gerade weil man den unglücklichen Ausgang von Anfang an kennt. Richard, der „Luftikus“, der als Kind von zu Hause wegläuft und nicht viel spricht, als Erwachsener jedoch alle mit seinen Geschichten verzaubert, wird jung sterben. Der einfach anmutende Satz, mit dem Monika Helfer den Suizid ihres Bruders bereits auf der zweiten Textseite vorwegnimmt, ist beispielhaft für ihre lakonische, extrem verknappende und gleichzeitig bildstarke Sprache:
Er sah aus wie der hübsche Bruder von Alan Wilson, dem Sänger von Canned Heat, der war damals schon tot, er hatte sich mit siebenundzwanzig das Leben genommen – Richard würde es mit dreißig tun. (S. 10)
Erstaunlich, mit welch kleiner Geste die Erzählerin ihrem Helden ein Gesicht und der Geschichte eine Richtung verleiht, dazu noch einen popkulturellen Kontext und einen zeitlichen Rahmen, die Siebziger Jahre, in denen Musiker vom Schlag eines Alan Wilson ebenso wie die in Stammheim inhaftierten Mitglieder der Baader-Meinhof-Gruppe durch ihren frühen Tod zu tragischen Idolen wurden. Auch die Erzählerin sympathisiert mit der Untergrundguerilla und erinnert sich sehr genau an die Fahndungsplakate, die beim Zollhäuschen an der Straße nach Lindau hingen:
Eines der Plakate war schon alt. Es sah aus wie die Ankündigung eines Rockkonzerts. Die Köpfe von Baader, Raspe und Ensslin waren mit Kuli durchgestrichen, noch vor ihrem Tod. Jan-Carl Raspe sah aus, als wäre er ein möglicher neuer Gitarrist der Rolling Stones, vielleicht hatte ja nach Mick Taylor auch Ron Wood das Handtuch geworfen. Auch der Kopf von Ulrike Meinhof war durchgestrichen. Ein Jahr vor den anderen hatte sie sich in ihrer Zelle erhängt. Die Gedanken an sie hatten mich lange nicht losgelassen. Ich dachte: Eine Kleinigkeit anders in meinem Leben, und ich wäre eine wie sie. (S. 120).
Dem jungen Richard, zweifellos selbst ein Grenzgänger, ist dieses politische Nachdenken fremd, er summt seine Lieblingsnummern „On The Road Again“ und „Going Up The Country“ von Canned Heat den Blindschleichen vor, den Fischen, seinem zugelaufenen Hund, den er nach dem babylonischen Sonnengott Schamasch nennt. „Pale Blue Eyes“ von Lou Reed wird später sein Gutenachtlied für Putzi. Vollkommen absichtslos und etwas verloren schlendert er durch sein Leben, mit seinem lässigen Gang, den er der englischen Krankheit verdankt, und seinem Lächeln, das den Frauen gefällt. Versunken in seiner eigenen Welt, scheint ihn nichts zu erreichen, bis Kitti in sein Leben tritt oder besser schwimmt und ihn, den Nichtschwimmer, aus dem Bodensee rettet, um ihn kurz darauf in die Pflicht zu nehmen. Sie vertraut ihm ihre dreijährige Tochter Putzi an, während sie zur Entbindung ihres zweiten Kindes ins Spital muss. Lange Zeit hört er nichts von ihr, mit einer kurzen Unterbrechung bleibt Putzi schließlich ein ganzes Jahr bei Richard. Dieser unternimmt nichts, denn er liebt das Kind, und er liebt sein neues Leben mit diesem Kind. Alle Warnungen schlägt er in den Wind.
„Richard, so kann das nicht weitergehen.“, sagt Monika zu ihm, „Du bist nicht ihr Vater.“ „Und?“ „Wenn dich jemand anzeigt.“ „Wer?“ „Jemand sieht einen Mann mit einem Kind, der bisher kein Kind gehabt hat, der Mann wohnt allein mit dem Kind. Das genügt. Was fragen die in der Setzerei?“
„Die fragen nichts. Ich habe ihnen gesagt, sie ist dein Kind und du bist auf Weltreise.“ „Das hast du nicht gesagt.“ „Ich habe gesagt, Putzi ist Gretels Kind, und Gretel ist auf Weltreise.“ „Das hast du auch nicht gesagt.“ „Ich habe gesagt, Putzi ist Renates Kind, und Renate ist in Berlin und kann sie gerade nicht brauchen, weil sie psychische Probleme hat.“ „Du bist ein Schmähtandler!“, sagt sie. (S. 115)
Der Satz „Liebe und Angst gehören zusammen.“, den Richard in der Erinnerung seiner Schwester zitiert, erscheint programmatisch für alles,
was nun folgt. Der Verlust des Kindes ist unausweichlich, und Richard geht sehenden Auges in die Katastrophe. So kompromisslos und direkt, wie er auch malt:
Wenn er malte, dann von morgens bis in die Nacht hinein. Rauchte nicht einmal dabei. Mit dünnen Pinseln malte er. Landschaften, in denen Menschen stehen. Zimmer, in denen Menschen stehen. Fußballplätze, auf deren Rängen Menschen stehen. Straßen, auf denen Menschen stehen. Hochzeitsbilder mit vielen Gästen. Keine Bewegung. Niemand geht oder läuft oder reitet oder schwimmt oder fährt mit dem Rad. Bilder wie an Dornröschens Geburtstag. Alle Menschen schauen dem Betrachter direkt und starr in die Augen. Als wäre das Gesicht des Betrachters plötzlich über ihrem Horizont erschienen und der Schrecken hätte sie starr gemacht. (S. 32)
Erinnern, fragen und nachforschen sind integrale Bestandteile dieses sehr intimen Romans, oft befragt Monika Helfer ihren Mann, den Schriftsteller Michael Köhlmeier, der damals noch ihr Liebhaber und mit ihrem Bruder eng befreundet war. Nach Richards Tod etwa sagt er: „Ich weiß niemanden, dem das Leben so wenig wichtig war wie dem Richard.“ Und weiter: „Ihm wäre interessanter gewesen, in einer Badewanne über den Rheinfall zu stürzen, als wichtiger, dabei zu überleben.“ Ein Satz, der sehr gut in einem Buch von Michael Köhlmeier stehen könnte, doch Monika Helfer schreibt: „Die Art, wie dieser Satz gebaut war, war typisch für meinen Bruder – Michael hat ihn zitiert.“ (S. 13f)
In sehr persönlichen Szenen wird neben dem Erinnern auch das Schreiben selbst zum Thema des Romans: Monikas sparsamer, Michaels ausufernder Umgang mit Sprache, das gegenseitige Korrektiv. Und nicht zuletzt die Frage nach der Wahrheit des Erzählten. „Und das hast du ihm geglaubt?“, ruft die Autorin aus, als ihr Mann berichtet, Richard habe sich als achtjähriges Kind fünf Tage in einer Höhle versteckt. Erst ein Zeitungsausschnitt aus dem fraglichen Sommer bringt schließlich Gewissheit. Gleichermaßen wahr UND erfunden seien ihre Porträts, erklärt Monika Helfer immer wieder, im Roman „Vati“ wird diese Frage sogar prominent am Textanfang platziert. Letztendlich zähle nur, wie gut eine Geschichte sei. Ein Roman ist ein Roman ist ein Roman! Auch „Löwenherz“ lebt zweifellos weniger vom realen Vorbild als
von Monika Helfers Kunst, daraus eine Geschichte zu entwickeln, die uns über viele Buchseiten fesselt. Die Vermutung, die Figur des Kindes könnte erfunden sein, drängt sich in diesem Zusammenhang sofort auf, und die Bestätigung hinterlässt einen Anflug von Enttäuschung: „Ich wollte ihm etwas geben, das er liebhaben kann.“, höre ich die Autorin in einem Interview sagen. Wahr ist – auch als Leser/in will man dieses Kind nicht mehr hergeben!
Monika Helfer, deren erster Prosaband „Eigentlich bin ich im Schnee geboren.“ bereits 1977 erschien, übrigens mit Illustrationen ihres Bruders Richard, hat über 20 Bücher publiziert, bevor sie mit ihrer Familientrilogie zur Bestsellerautorin wurde. Viele ihrer früheren Romane und Erzählungen beschäftigen sich ebenfalls mit Kindern und schwierigen Familien-
verhältnissen. Erst jetzt, da sich das Genre der Autofiktion im Gefolge von Didier Eribon oder Annie Ernaux zu einem Publikumsrenner entwickelt, erhält auch Monika Helfers Literatur die Aufmerksamkeit, die sie gewiss schon viel länger verdient hätte. Bemerkenswert ist dabei, mit welch freundlichem, ja zärtlichem Blick sie dieses ursprünglich doch etwas kantigere Genre für sich adaptiert. Die Fürsorge füreinander ist ein zentrales Thema ihrer Familien-
romane, auch oder gerade dort, wo sie weitgehend fehlt. Richard sorgt für ein fremdes Kind, und seine Schwester fühlt sich für ihn verantwortlich, seit er ihr, der damals Sechsjährigen, als Baby vom Wickeltisch auf den Boden gefallen ist. Selbst ihrem Vater, der seine vier Kinder nach dem Tod der Mutter im Stich ließ, begegnet die Autorin mit großer Offenheit. Ihm ist auch der neue Buchtitel geschuldet: Löwenherz war sein Kosename für Richard. Die versäumte Beziehung dieser beiden zerbrechlichen Männer ist jedoch eines der Dinge im Roman, die sich nicht fügen können. Auch diese Tatsache bringt die Autorin so empathisch wie unsentimental auf den Punkt:
Gefühle waren für unseren Vater ein unauflösliches Knäuel und für Richard nicht besonders interessant. Übersetzt in Allerweltsliebessprache hieß „Löwenherz“ für unseren Vater: Du bist mein Ein und Alles. Richard wollte niemandes Ein und Alles sein. (S. 45)
Je tiefer man als Leser/in in Monika Helfers unglaublichen Familienkosmos eintaucht, desto mehr hat man das Gefühl, dass dort noch viele Figuren auf ihren Auftritt warten. Die Autorin präsentiert sich mit Löwenherz in literarischer Höchstform, der Text erscheint noch stringenter und klarer organisiert als die beiden Vorgängerromane. Was danach kommt, bleibt auf jeden Fall spannend!