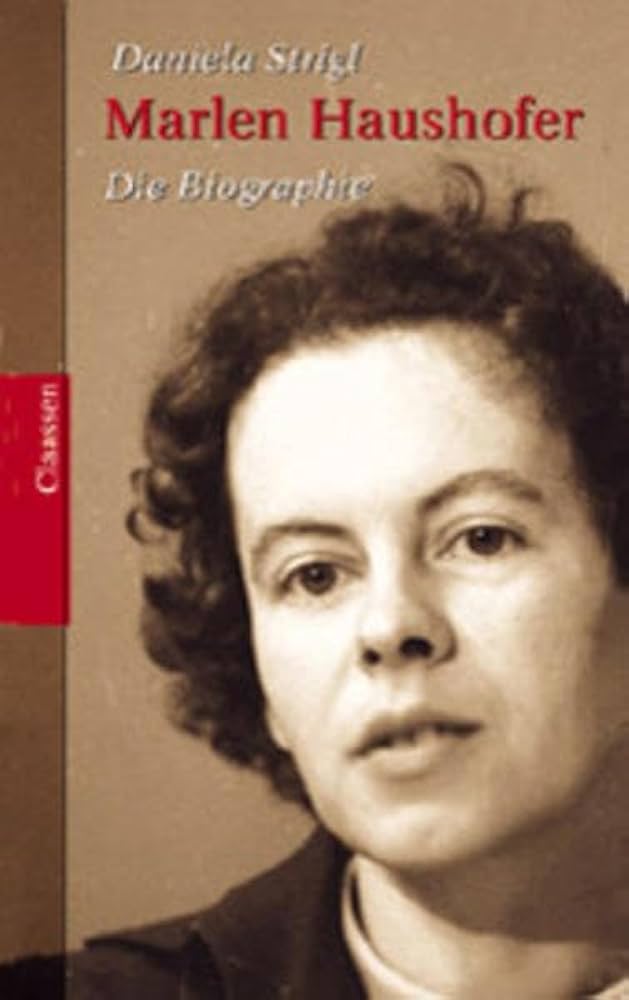Diesen Mythos vom Opferlamm, um nicht zu sagen, diese Heiligenlegende, unterläuft Daniela Strigls Biografie, wenn auch nicht allzu radikal. Sie zeigt – gewiß nicht vorsätzlich – eine Marlen Haushofer, die durchaus mit Kalkül und kühler Brutalität handelte: Als sie als Zwanzigjährige schwanger wird und die Verbindung zum Vater ihres Kindes aus heute nicht mehr auffindbaren Gründen in die Brüche geht, heiratet sie kurzentschlossen einen anderen, jenen Zahnarzt, der als eine Art oberösterreichischer Charles Bovary in die Literaturgeschichte eingehen sollte, als Tölpel, der seiner Emma nicht das glanzvolle Leben bieten kann, das sie sich erträumt. (Wer wird jemals für ihn Partei ergreifen, der ein Leben lang Zähne plombieren mußte, während seine Frau der Mittelmäßigkeit der Kleinstadt immerhin zeitweise in die Welt der Literatur entfliehen konnte, wenn auch nur in die Mittelmäßigkeit der Wiener Literaturszene der 50er Jahre?)
Emma Bovary nahm sich einen Liebhaber, Marlen Haushofer nahm sich gleich mehrere: Hakel, Weigel, Federmann, lauter Männer, die ihr den Weg als Schriftstellerin ebnen konnten. Zuvor allerdings entledigt sie sich, auch darin ganz Emma Bovary, ihres ersten Kindes. Sie deponiert es bei der Mutter einer Freundin, wo es bis zu seinem vierten Lebensjahr bleibt.
Aber auch später, als der Sohn aus ihrer ersten Beziehung zumindest dem Schein nach in die Familie Haushofer aufgenommen wird, bleibt er ein ungeliebter Außenseiter. Er darf nicht mit auf Urlaub, und als er später als Kaufmannslehrling seiner Mutter zum Geburtstag ein Stück geblümten Stoff schenkt, verscherbelt sie es zu einem Spottpreis ihrer Nachbarin.
Marlen Haushofer ist keine Ingeborg Bachmann, mit der sie gern verglichen wird. Weder in ihrer Literatur, noch in der Radikalität ihres Denkens und Lebens. Marlen Haushofer ist österreichische Provinz, und um der Mittelmäßigkeit der österreichischen Provinz zu entfliehen, hätte sie wahrscheinlich nicht nur Steyr, sondern Österreich hinter sich lassen müssen.
Sie aber bleibt und schreibt Bücher, Romane und Erzählungen, die der Scheinidylle des Lebens in der Kleinstadt Kälte und Beziehungslosigkeit entgegensetzen. Daniela Strigl meint, Marlen Haushofer hätte genau dieses Milieu des muffigen, engstirnigen Kleinbürgertums gebraucht, um ihre Werke schreiben zu können, als „flotter Single in Wien“ wäre sie ihres Themas verlustig gegangen. Dem wäre wahrscheinlich noch hinzuzufügen, daß nicht nur die Autorin, sondern auch der Mensch Marlen Haushofer die Enge und vermeintliche Geborgenheit der Kleinstadt brauchte, die Enge und offenbar nur in ihrer Unerträglichkeit aushaltbare Nähe zu ihrem Mann, von dem sie sich einmal scheiden läßt, den sie jedoch nie verläßt. Und andererseits die wiederum nur aus der Ferne wünschenswerte Utopie der Wiener Literaturszene, der sie zwar hin und wieder einen Besuch abstattet, der sie jedoch nie so richtig angehört.
Denn Kälte und Beziehungslosigkeit herrschten offenbar nicht nur in der Welt, die Marlen Haushofer beschreibt, sondern auch in ihr. Etwas radikaler formuliert: Durch die Brille der eigenen Kälte und Beziehungslosigkeit gesehen, kann sich die Welt nur in ihrer Kälte und Beziehungslosigkeit offenbaren. So erscheint denn auch die in Daniela Strigls Biografie zitierte Interpretation, die Erika Danneberg, eine Freundin Marlen Haushofers, für den Roman „Die Wand“ lieferte, als passend und dem feministischen Opferquatsch haushoch überlegen: „Die Wand“ als Beschreibung einer Psychose, als narzißtische Größenphantasie, in einer Welt ohne (menschliche) Objekte überleben zu können.
Auch Daniela Strigl versucht sich in Psychologisierungen, was sie allerdings lieber hätte bleiben lassen: Jemandem ödipale Phantasien und den regressiven Wunsch, in den Mutterleib zurückzukehren, nachzuweisen, ist ungefähr genauso originell wie die Behauptung, jemand besäße Herz, Niere und Lunge.
Viel interessanter erscheint im Hinblick auf Marlen Haushofers Literatur der Mechanismus der Projektion, mit dessen Hilfe sich Täter (oder sich als Täter fühlende) gerne zum Opfer stilisieren, um der eigenen Aggression Herr zu werden: In „Eine Handvoll Leben“ ist es immerhin die Protagonistin, die ihre Familie verlassen hat, und in „Die Wand“ tötet die Ich-Erzählerin den als Eindringling wahrgenommenen Mann (erst gegen Ende des Romans und nachdem er ihren Hund und ihren Stier erschlagen hat, aber so unlogisch kann Literatur sein).
Marlen Haushofer stirbt jung, mit fünfzig Jahren, an Krebs. Emma Bovary blieb im Rahmen der konservativen Dramaturgie des bürgerlichen Romans nichts anderes übrig, als sich auf qualvolle Weise umzubringen, Marlen Haushofers Krebstod scheint ein letztes Mal die Opfertheorie zu besiegeln. Auch Daniela Strigl kann es sich nicht verkneifen, ausführlich die „landläufige Meinung“ zu zitieren, Krebs sei gewissermaßen die Strafe für nicht gelebtes Leben oder nicht ausgelebte Gefühle. Als ob es einen Idealpunkt gäbe, von dem aus ein Leben als gelungen oder nicht gelungen zu betrachten sei.
Dem steht die Luzidität und Abgeklärtheit entgegen, mit der Marlen Haushofer selbst das (ihr) Leben sah und beurteilte: „Die Frauen mühen sich ein Leben lang ab, zu kochen und zu putzen, und die Männer mühen sich ein Leben lang ab, um das zu finanzieren.“