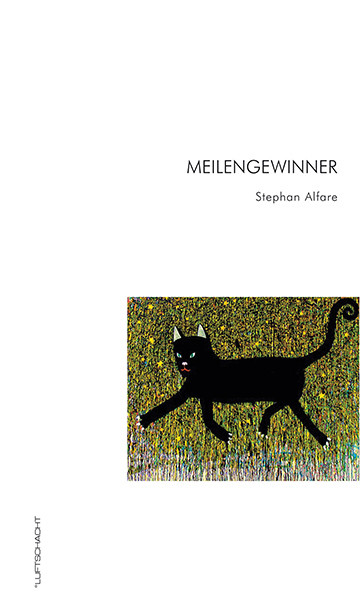Peter Rosei stellt seinen rund zwanzig Jahre jüngeren Kollegen Stephan Alfare für den Roman „Das Schafferhaus“ (2006) in den Kreis von Innerhofer und Wolfgruber. Ich stimme Rosei zu und darf seine Charakterisierung insofern erweitern, dass Alfares „Heimatgeschichten“ nicht nur in Österreich spielen, sondern in vielen Gegenden Mittel- und Südeuropas, was sie heutiger macht. Alfares neue Prosa „Meilengewinner“, die Gattungsbezeichnung Roman findet man nirgendwo im Buch, ereignet sich hauptsächlich in Österreich, „Jugoslawien“, Griechenland, in der Türkei und in Frankreich, wo der Prosa-Held die Freiheit und das Abenteuer sucht. Der Ich-Erzähler, der in Österreich Gräber ausgehoben hat, bricht ohne konkretes Ziel und mit wenig Barem nach Süden auf. Er reist per Zug und Schiff, vor allem aber mit dem Daumen, wobei sich bewahrheitet, dass auf der schmutzigen Landstrasse am liebsten die LKW-Zug-Chauffeure abbremsen, obwohl ihr Anhalteweg der längste ist. Viel Gepäck ist nicht zu transportieren, doch immer genug Alkohol. Genau genommen bestimmen zufällige Begegnungen die Reiseroute und das Leben des Erzählers.
Stephan Alfare erzählt glaubwürdig von seinem Vagabundenleben. Die Kurzbiographie weist nämlich eindeutig auf autobiographische Elemente hin. Er schreibt über die Arbeit in den Obstplantagen und andere Gelegenheitsjobs, womit er Geld zum Überleben verdient. Der Leser und die Leserin verbringen mit ihm und anderem Erzählpersonal Tage und Nächte in griechischen Hafencafés und Höhlen am Meer. Die Sitten sind rau, die Bekanntschaften nicht selten herzlich und der Sex meist trist. Nicht wenig Unappetitliches kommt, um das Buch auf gewisse Weise aufzufetten, zur Sprache.
Der Reiz dieser Prosa ist, dass es der Autor versteht, zärtlich und wie beiläufig von den Merkwürdigkeiten der Menschen und Landstriche zu erzählen, von der Heiterkeit, die aufkommen kann, aber auch von der ganzen Trostlosigkeit der Aussteiger, die es in der südlichen Hälfte unseres Kontinents offenbar zuhauf gibt. Man glaubt Alfare, wenn er behauptet: „Umso genauer du die Menschen beobachtest, desto öfter wirst du enttäuscht sein. So ist das nun mal. Du brauchst nur dich selber beobachten.“
Beim Anlesen seiner Sätze hat man immer wieder das Gefühl, Alfare verbreite Allgemeinplätze, benütze Klischees und dresche Phrasen, doch bereits beim fünften, sechsten Wort wird man auf eine neue sprachliche Lösung aufmerksam. Floskeln und Plattitüden sind jedenfalls nicht sein Fach.
Stephan Alfares Prosa ist mit der neuen slowenischen verwandt, in der ein „Jour“ nach dem anderen abgefeiert und ordentlich abgetanzt wird. Seine „pechschwarzen, ausgekochten Hurenaugen“ und das „Haschischrauchen“ könnte genauso bei Brane Mozetič nachzulesen sein. Der gemeinsame Nenner ist das maritime Gefühl, das mit dem Gebrauch einer leichtfüßigen Sprache erzeugt wird: „Wir brauchten keine Sprache, um einander zu verstehen: wir hatten ein Radio und die Dezembersonne auf der Insel.“ Lässig wirkt der Text vielleicht dort, wo der Philosoph Emil Cioran zum „geilen Burschen“ wird. Und manchmal sind Stephan Alfares Bilder besser zu verstehen als seine Sprache, besonders an den Stellen, an denen er „ein knappes Dutzend Sonnenstrahlen“ stilistisch zum Blühen bringt.