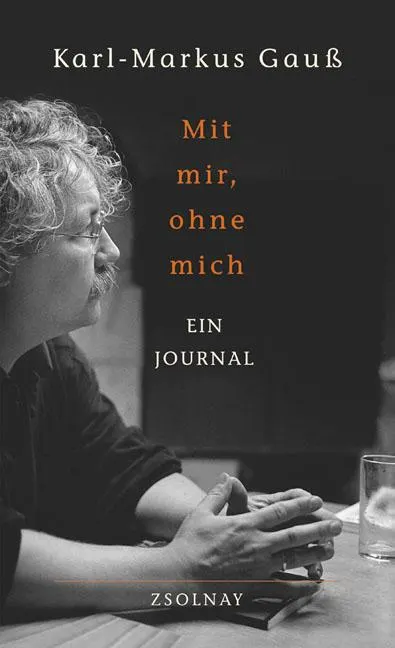Ein Jahr mit Gauß: Was man bisher aus Zeitschriften, Einzelveröffentlichungen zusammentragen konnte, liegt nun gesammelt, verdichtet und in eine durchaus auch persönliche Form gebracht in einem Buch vor. Mit mir, ohne mich ist ein anregender Spaziergang, der entlang der Hauptrouten führt, um dann mit Vorliebe unvermutet auf einem ruhigen Seitenweg zu landen. Zu Mainstream: „Die Frage, ob man für oder gegen Pop sei, ist also sinnlos, ja unverständlich, als wäre ein Europäer des 16. Jahrhunderts gefragt worden, ob er für oder gegen das Christentum sei“. Zum eigenen Schreiben: „Ich muß es aber schreiben, weil ich nur im Schreiben so gescheit bin, wie ich sein kann.“ Zum Phantasma Europa: „Udine erweckt diesmal einen unangenehm herausgeputzten Eindruck, als hätten diese Udineser entdeckt, dass sie lieber doch keine Italiener, sondern Geschäftseuropäer sein möchten“. Zu den frisch aufgekommenen Containern, der „Schule des Totalitarismus“ und Reality-Formaten im Fernsehen: „Gelehrt wird, wie man Observation als Genuß erlebt und sich als tugendhafter Staatsbürger von morgen dankbar darum anstellt, überwacht, kontrolliert und seiner Persönlichkeit beraubt zu werden“. Man findet viele solch pointierter Beobachtungen eines eigenwilligen Standpunktes.
Ein Journal nennt Gauß seine Textsammlung zwischen Erzählung, Essay, Tagebuch, Polemik und Beschreibung. Was das Buch abseits von gedanklichen Inhalten spannend macht, ist, wie man beobachten kann, wie jemand seine persönliche Wahl trifft, wie jemand versucht, sich zu positionieren. Dazu gehört auch, daß Gauß mehr als einmal zu oft seine Außenseiterrolle betont. „Ach, Salzburg, vielleicht bin ich überhaupt nur geblieben, weil ich mich immer verteidigen mußte, es zu tun.“ So etwas kennt man eigentlich nur aus der Schule, daß sich Außenseiter so in ihrer Außenseiterposition verbunkern, dass es etwas Primadonnenhaftes und leicht sektiererisch Verhärtetes bekommt. Gauß kokettiert mit dem Unerfolgreichen, und nimmt dabei, wie Ulrich Weinzierl in seiner Besprechung in der „Welt“ so treffend anmerkt, mitunter das „Pathos eines Rächers der Enterbten“ an: „Spontan neige ich dazu, die erfolglosen für die wahren Schriftsteller zu halten“. Metropole und Avantgarde werden zu Haßwörtern, denen vor allem die Peripherie entgegengehalten wird.
Ganz bei sich wirkt Gauß hingegen, wenn er über Autorinnen und Autoren schreibt, die er liebt. Da schlägt der positive Entdeckerwille durch, etwa bei dem slowenischen Nationaldichter Francé Preseren oder der österreichischen Autorin Klara Blum. Immer wieder taucht auch das Tagebuchmotiv auf. Welche Schriftsteller haben aus welchen Gründen Tagebuch geschrieben, vom „Geheimtagebuch“ eines Samuel Pepys bis zu Heimito von Doderers Versuchen, in seinem Tagebuch philosophische Begriffe für sein Werk zu definieren. Man findet eigenwillige Beobachtungen und Schlüsse, von denen man sich gerne anstecken lassen möchte ebenso wie Urteile, denen man aufs heftigste zu widersprechen gewillt ist. Gauß mutet sich viel zu, er schreibt über alles, von Kunst bis Fußball, von Politik bis zur Sonnenfinsternis. Sagen wir so: Mancher Subjektivität folgt man lieber als der anderen, zumal, wenn sie sich dann doch zum eher allgemeingültigen Urteil aufschwingt. Wenn Gauß etwa bei den Salzburger Festspielen Frank Castorfs (Gauß: „nicht der einzige Holzhacker auf dem Theater“) Theaterinszenierung „Endstation Amerika“ sieht und Figurenentwicklung, wie sie bei Tennessee Williams vorgezeichnet ist, vermißt, dann legt das einfach nur falsche Leisten an. Von Castorf Figurenentwicklung zu verlangen, macht ungefähr so viel Sinn, wie in einem Fleischerladen partout empört zu sein, weil es keinen Bio-Tofu gibt. Am liebsten mag man das Buch, wo sein Autor nicht kämpfen muß, sondern einfach nur schauen kann und uns mitschauen läßt. Urteile hat schließlich jeder von uns (viel zu) schnell zur Hand.