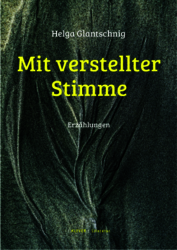Auch die Autorin Helga Glantschnig hat mit ihrem soeben erschienenen Band Mit verstellter Stimme Erzählungen vorgelegt. In ihnen steht jedoch nicht die eigentliche „Story“ im Mittelpunkt, sondern vor allem die Perspektive, aus der heraus erzählt wird. Schon das vorangestellte Motto von Jean Paul „Das Ich gilt, aber nicht mein Ich“ weist den Weg dorthin. Glantschnig schreibt scheinbar aus der Sicht von Personen, Dingen, Gebäuden, die Titel ihrer Geschichten beginnen stets mit einem unbestimmten Artikel: „Eine Ruine“, „Ein Eindringling“, „Ein paar Bergschuhe“. Das Ergebnis mutet an wie ein vielteiliges Puzzlespiel, mit welchem ein Ich zu (re-)konstruieren ist, das mit dem Ende der Geschichten noch längst nicht vervollständigt zu nennen wäre. Aber es ist sich, und so mag es auch den LeserInnen bei der Lektüre gehen, womöglich ein Stück näher gekommen. Insofern hängen diese Geschichten alle zusammen. Doch sie funktionieren sprachlich natürlich auch jede für sich, sind sie doch stilistisch entsprechend so unterschiedlich, wie es nur sein kann: etwa die alles überblickende, zeitenthobene Position der „Ruine“, die den hektischen, mit drei Punkten aneinandergefügten Halbsätzen des „Eindringlings“ entgegensteht, mutmaßlich eine männliche, stark verwirrte Person, die in ihr ehemaliges Zuhause an der Seite einer Frau, die sich offenbar von ihr getrennt hat, einbricht.
Dabei entsteht mitunter so etwas wie ein kompletter Lebensabriss, etwa in den bereits erwähnten „Bergschuhen“ oder auch in „Eine Großmutter“, wo man sich als LeserIn unwillkürlich fragt, ob hier seitens der jeweiligen Erzählinstanz echte Reflexion oder eher Konstruktion, also gewissermaßen Behauptung über gelebtes Leben, vorliegt:
„Ich war dankbar, dass ich weiterkam, dass ich etwas dazulernte, es freute mich, mich zu erweitern, Freude ist ja nicht Lustigkeit, Belustigung. Frohen Herzens trennte ich Nähte auf, verlängerte, verkürzte Kleidungsstücke, flickte, stopfte ich, wie es meine Gewohnheit war.“
Und die Großmutter bleibt bei dieser innerhalb der Erzählung unhinterfragten Haltung des Dienens, die gar als Persönlichkeitsentfaltung umgedeutet wird, selbst als sie einen überlebenden Soldaten des Ersten Weltkrieges heiratet:
„Redselig war er nicht, erst das Bier lockerte die Zunge. Damit du weißt, pflegte er sodann zu sagen, du bist. Nichtwahr? Kein Untergang. Meine Gesellschaft machte ihm Mut, so wurden wir Mann und Frau, fürwahr.“
Nein, kein Untergang, fürwahr, möchte man konstatieren, aber nicht doch eher ein Leben als Summe von Selbsttäuschungen?
Doch so verhältnismäßig geradlinig geht es in den wenigsten der Erzählungen vor sich, die alle einen Umfang zwischen vier und sieben Buchseiten haben. Wie die Scherben eines Spiegels zeigen sie jeweils einen Ausschnitt eines Ichs, welches gar zu den Lesenden selbst gehören könnte, wenn sie es denn bei der Lektüre zuliessen und Glantschnig schafft es immer wieder, vertraute Blickwinkel zu finden, die wir alle aus unserem eigenen Dasein kennen, die verloren geglaubte Momente unseres Lebens wieder aufrufen und vergegenwärtigen. In Landschaftsbeschreibungen, inneren Monologen, gar dem Spiel mit dem gedanklichen Transzendieren eines unbelebten Objekts – „Ein Briefkasten“ etwa konstatiert:
„Es macht mir Vergnügen, mich in andere Existenzen hineinzudenken. Ohne es zu beabsichtigen, befinde ich mich in einer parallelen Welt. Als Maus. Als Eidechse. Als ein Winden und Gleiten im Gras, ein trockenes Rascheln, Huschen.“
In „Ein Spiegel“ geht das Transzendieren so weit, dass der Spiegel und der sich in ihm betrachtende Mensch gleichsam zu verschmelzen scheinen. Das Verfahren erinnert ein wenig an die anthropologische Philosophie eines Helmuth Plessner und seinen „unaufhebbaren Doppelaspekt von Innen und Außen“, das ständige Oszillieren zwischen menschlicher Selbstobjektivierungsperspektive und leiblicher Wahrnehmung, nur dass es ohne Aufhebens die schriftstellerische Möglichkeit der entsprechenden Kontextualisierung von eigentlich vollkommen unbelebten Dingen in sich birgt. Mit scheinbar naiver Selbstverständlichkeit schickt Glantschnig ihre Leserschaft immer wieder auf diese wirkungsvolle Melange aus emotionalem und intellektuellem Eis.
Auch die intertextuellen Verschränkungen fallen auf, die motivisch die oberflächlich betrachtet so unterschiedlich scheinenden einzelnen Erzählungen zusammenhalten. So spricht das Alter Ego einer Toten etwa von sich als einer Kurzsichtigen, ihre Myopie sei das Geheimnis ihrer eigentlichen Hellsichtigkeit. In der Folge findet sich auch der Text „Eine Kurzsichtige“, dessen Protagonistin ihr Gebrechen durch eine erstaunliche Gabe an Interpolationsfähigkeit lange verheimlichen kann. Ihre am Ende der Erzählung erwähnte sterbende Mutter schlägt wiederum den Bogen zu „Eine Tote“. Fürwahr, man stimmt der Autorin zu, wenn sie bemerkt: „Alles fließt in Übergängen“.
Helga Glantschnig, die sich seit einem Vierteljahrhundert dem Schreiben widmet und die dafür insgesamt ein eher schmal zu nennendes Oeuvre vorgelegt hat, nimmt sich Zeit in ihren achtundzwanzig Erzählminiaturen. Und das ist gut so, denn jeder Satz, jedes Wort hat im Kontext ihrer Sprachschöpfungen Goldwaagencharakter. So leichtfüßig, wie sie mitunter daherkommen, können sie in ihrer inneren Konsequenz und ihrem poetischen Gehalt fast den Anspruch erheben, in Prosa gegossene Dichtungen zu sein, die sich im Lauf des Lesens zu einem Zyklus über die Möglichkeiten von Ich-Perspektiven auswachsen. Das schließt nicht Alltagssprache aus, nicht klassische Syntax oder nur sehr verborgen obwaltende Sprachrhythmik, im Gegenteil. Doch die mal traumwandlerisch, mal knochentrocken gestalteten Blickwinkel auf im Ganzen doch eher gewöhnliche Ereignisse aus verschiedensten Erlebensbereichen lassen den Schluss zu, dass die „Künstlichkeit alles Erzählten“, wie es der Klappentext nennt, durch ein ausgeklügeltes poetisches Verfahren der Autorin ins Werk gesetzt wird, das implizite Anleihen bei moderner Lyrik macht, in welcher das Subjekt viel größere Freiheiten genießt als in der herkömmlichen Prosa. In jedem Falle bestätigt Glantschnig eindrucksvoll den Anspruch des Klever Verlags „ein lustvolles Laboratorium für avancierte Gegenwartsliteratur“ zu sein.