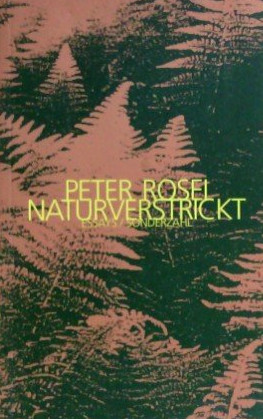Rosei führt einen „zweisprachigen“ Diskurs mit sich selber: als Forscher stellt er die Fragen begrifflich-philosophisch, als Künstler antwortet er bildlich-poetisch. Ein Beispiel: „Werden wir von der Natur bestimmt, oder bestimmt das Naturhafte in uns die umgebende Natur?“ Darauf: „Einmal sah ich einen lgel durch ein Wäldchen gehen. Der Bursche war prächtig aufgelegt. War ja auch ein freundlicher Tag. Ich folgte dem Igel, wurde immer fröhlicher. Wohin er denn ging? Durch das Wäldchen!“ (S. 16)
Derart sind die Bildantworten oft Bilderrätsel, die der Leser noch zu lösen hat. Manchmal erscheint ein ganzes philosophisches Konzept ins Mikroskopische verkleinert, der Leser muß es ins Verständliche vergrößern. So etwa erkennt man Sisyphos, ungenannt, „der Größe nach einer Laus vergleichbar, der winzige Steinchen die Abhänge hinaufzurollen versucht.“ (S. 18) – Der Leser hat’s nicht leicht.
Aber auch der Autor hat’s nicht leicht. Er irrt als „Herumgetriebener“ (S. 12) in seinem Einbildungslabyrinth von einem versperrten Ausgang zum anderen. Er stolpert durch eine „Kulissenlandschaft […]. Man könnte diese Landschaft auch sibirisch nennen, in ihrer aufrichtigen Einladungsgeste zum Verrecken“ (S. 12). Die Welt ist ihm inhomogen, voller Fallen, hat eine „Löcherstruktur“. Der Verstrickte erschrickt vor dem Naturhaften in sich selbst, ihn befallen „Gebirge der Angst“ (S. 15), er findet sich an den „Ränder[n] des Mahlstroms“ (S. 25), er erlebt das Leben als eine Höllenfahrt. Scheinlösungen werden verworfen: Sich verlieben? – welche Illusion! (S. 26) Schließlich fragt der Dichter nach der Macht der Sprache: Läßt sich Natur vielleicht mit ihr zähmen? Nein, auch sie gehört zur Natur: „Wir tragen ein doppeltes Gewand: das der Welt, die uns umgibt; das der Namen, die wir den Umgebungen geben. Uns eigentlich ist fast nichts.“ (S. 34) Die Befragung endet – natürlich – wieder in einem Bild: Wir stehen auf Felsklippen, sehen aufs Meer hinaus, der Dunst schafft die Luftperspektive „und zwar so, daß die näher zu uns herragenden Teile weit schärfer und deutlicher vor uns standen als die entfernten.“ (S. 36) Dunst als Erkenntnishilfe: das Paradox als typisches Verstrickungsmuster. Rosei läßt uns mit dem Fragment stehen, er verweigert sich und uns das letzte Wort.
Der zweite Essay, „Ein philosophisches Notizbuch“, ist auf Reisen entstanden und wird gleich als Fragment vorgestellt. Skizzen, Anmerkungen, Aphorismen, allerlei Verstreutes: Lehrsätze über Toleranz und Leid, Ansätze zu seiner Schreibtheorie, man sieht ihn kämpfen gegen die Angst, das Fremde, das Alleinsein, er lädt den Ärger ab über die Dummen, Heuchler, Bösen. Selbstgespräche eines Einzelreisenden. Wieder richtet sich ein Hauptaugenmerk auf Natur, wie sie sich selber zeigt und wie wir mit der Sprache dazu „eine Abfolge von Fingerzeigen und Winken [entwerfen], mit denen wir die Dinge umgeben“ (S. 40). Die Zeigerstruktur der Sprache fesselt ihn, wenn er mit ihr wie „mit einem langen Stab [herumfuchtelt, um] den Geist der Dinge zu beschwören“ (S. 40). Der Künstler als Magier. Der Künstler aber auch als Anarch: wenn er Strukturen, „drinnen oder ‚draußen‘, es ist völlig egal“ (S. 74), destabilisieren muß. Das Chaos als Anfang bei ihm – wie in der Natur.
Der dritte Text ist als „Duett“ bezeichnet: ein Zweierauftritt 1996 im Literarischen Quartier in Wien, zusammen mit dem englischen Autor Redmond O’Hanlon. Echter Dialog nun: zwei Verwandte halten ihre Texte, Methoden, Welt-Anschauungen nebeneinander. Im Kontrast wird englisch-preußisch-protestantische Tradition gegen romanisch-katholische gestellt. Dort Darwin und die englische Naturtheologie ohne „Ballast der abstrakten Fragen“ (S. 102), hier Spinoza, Don Quixotte – und eben Rosei unter der Last seines „ganzen metaphysischen Krempel[s]“ (S. 101) stöhnend. Dennoch gibt er sich selber die heroische Empfehlung: „Der Künstler sollte diesen [philosophischen] Zähmungsakt so spät wie möglich vollziehen – er soll so lange nur irgend möglich an der Grenze zur Verzweiflung ausharren“ (S. 99).
So kann Verstrickung weiterführen!