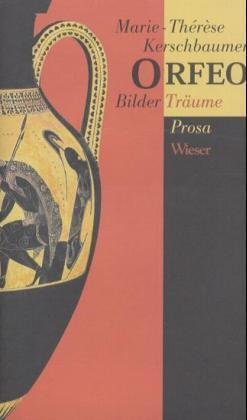Daß der Schrecken durch die Musen gebannt, daß die Bitternis der Erfahrungen durch das dichterische Wort aufgehoben werden können, mithin, daß Engagement und Artistik keine Gegensätze sind, bewies die Autorin nicht nur durch ihren ersten Roman, „Der Schwimmer“ (1976). Vor allem ihre Erzählungen über KZ-Opfer, „Der weibliche Name des Widerstands“ (1980) zeigten, daß solche Grenzüberschreitungen nötig und möglich sind. Dennoch blieb Marie-Thérèse Kerschbaumer in ihrem Schreiben wie in ihrem Engagement eine Außenseiterin des Literaturbetriebs. Es scheint, daß diese Literatur sich nicht nur durch ihren Anspruch, den sie an den Leser stellt, einer breiten Zustimmung verweigert. Das Nicht-Dazugehören, das Fremd-Sein, begründen Poetik und Weltsicht dieser Texte gleichermaßen. Teils biographisch verwurzelt (frühe Heimatlosigkeit, die Trennung von der Mutter, der mühsame Weg zur Sprache und Literatur), teils philosophisch eingeholt (Exzentrizität und Fremdheit als Existentiale), ermöglicht gerade der Blick von Außen die Schau der Dinge, Gegenwart, Erkenntnis: Sie werden vom erzählenden Ich zugleich als sinnliche Präsenz und Erfüllung, jedoch auch als tiefe Trauer wahrgenommen – eine Trauer, die angesichts der Menschen und ihrer heillosen Zustände alle Tagträume überlagert.
Mit Orfeo liegt eine Sammlung von Sprach-Gemälden vor, die verstreut erschienene „Bilder, Träume, Prosa“ aus zwei Jahrzehnten zusammenfügt. Entstanden im Umkreis ihrer größeren Projekte, ermöglichen sie eine Zusammenschau ihres verschlungenen Textgewebes. Kerschbaumer, von Roman Jakobsons strukturalistischer Sprachauffassung fasziniert, machte schon im „Schwimmer“ (fortgesetzt durch „Die Fremde“ und „Versuchung“) die poetische Funktion der Sprache, das Zeichen selbst zum Sprecher ihrer Botschaft. So sind diese Texte, selbst wenn sie sich augenscheinlich aus der Biographie entwickeln (wie etwa die „Traumbilder“), nie autobiographisch, sondern kunstvolle Artefakte, in denen Märchen, Mythen und traumhafte wie traumatische Erfahrungen übereinander geschichtet und bewahrt sind. Ob es sich bei dieser Prosa um die imaginäre Begegnung mit dem Geliebten („Aloe“), um Reiseeindrücke oder um Aktuelles handelt („Zeit und Welt und Zeit“, das Bergunglück zu Lassing thematisierend), immer spüren wir den Impuls, der die Erzählerin zum Schreiben treibt: Hochachtung vor der Sprache, die die Achtung auch vor dem Anderen enthält. „Was aber bleibt ist der Respekt des Schauenden, des Schauenden des Schauens, vor dem … vor dem … dem … (vor was?) vor was!!“
Ein Bekenntnis zur Welt liegt hier vor, zum Trotzdem, zum Wort, das – und das ist ihr persönliches Bekenntnis – Schönheit als Abglanz dieser Utopie zu zeigen hat: „oh, wie konnte uns entgehen, wie konnten wir der letzten Wahrheit oh, entliehen, nichts vermag der Dichter, keinem Übel vermag er abzuhelfen, und das Verbot des Rühmens, das Verbot der Lüge, das er sich auferlegt, es war sinnlos, tausendmal sinnlos und abersinnlos, denn dieses Verbot hatte längst die Rühmer und Lügner ereilt und jetzt war es Sitte zu schmähen und hohnzulachen der Ehre und Nichtlüge, und ein nicht endenwollendes Darstellen und Aufdecken und zur Schau Stellen des Unteren, Niederen, abstoßend Hässlichen brach an, Ekel hervorbringend (…)“. Wenn wie hier das Ungenügen gegenüber einer Literatur des Häßlichen und Obszönen geäußert wird (die ja doch durch zornige Autoren wie Rainald Goetz, Werner Schwab oder Elfriede Jelinek ihre großartigen Vertreter gefunden hat), dann meint das nicht die Themen, die Marie-Thérèse Kerschbaumer durchaus selbst in den Mittelpunkt stellt – die Position der Frau, die Marginalisierung der Opfer, Ohnmacht, Ungerechtigkeit und „gesättigte Verrohung“, von der die Autorin an anderer Stelle einmal sprach – sondern die Art und Weise des Sagens. Heute, da man nüchterne Prosa schätzt, mag die Komplexität und der hohe Ton ihrer Erzählungen befremden, wie umgekehrt Lyrik subjektiv zu sein hat. Beides unterläuft die Autorin. Sie psalmodiert in ihren Prosatexten und schreibt in Gedichte Poetologisches: „die mitteilung selbst die poetische funktion die dominierende und determinierende funktion sprachlicher kunstwerke bleibt nicht deren einzige funktion und verschiebungen innerhalb der struktur der funktionen sind möglich“, heißt es im Duktus eines wissenschaftlichen Exzerpts im Abschlußgedicht Orfeo. Darf man noch so singen und sagen? Marie-Thérèse Kerschbaumer hat sich diese Freiheit genommen und ?überzeugend, nicht zuletzt mit dem hier vorliegenden, schön gemachten Buch, eingelöst.