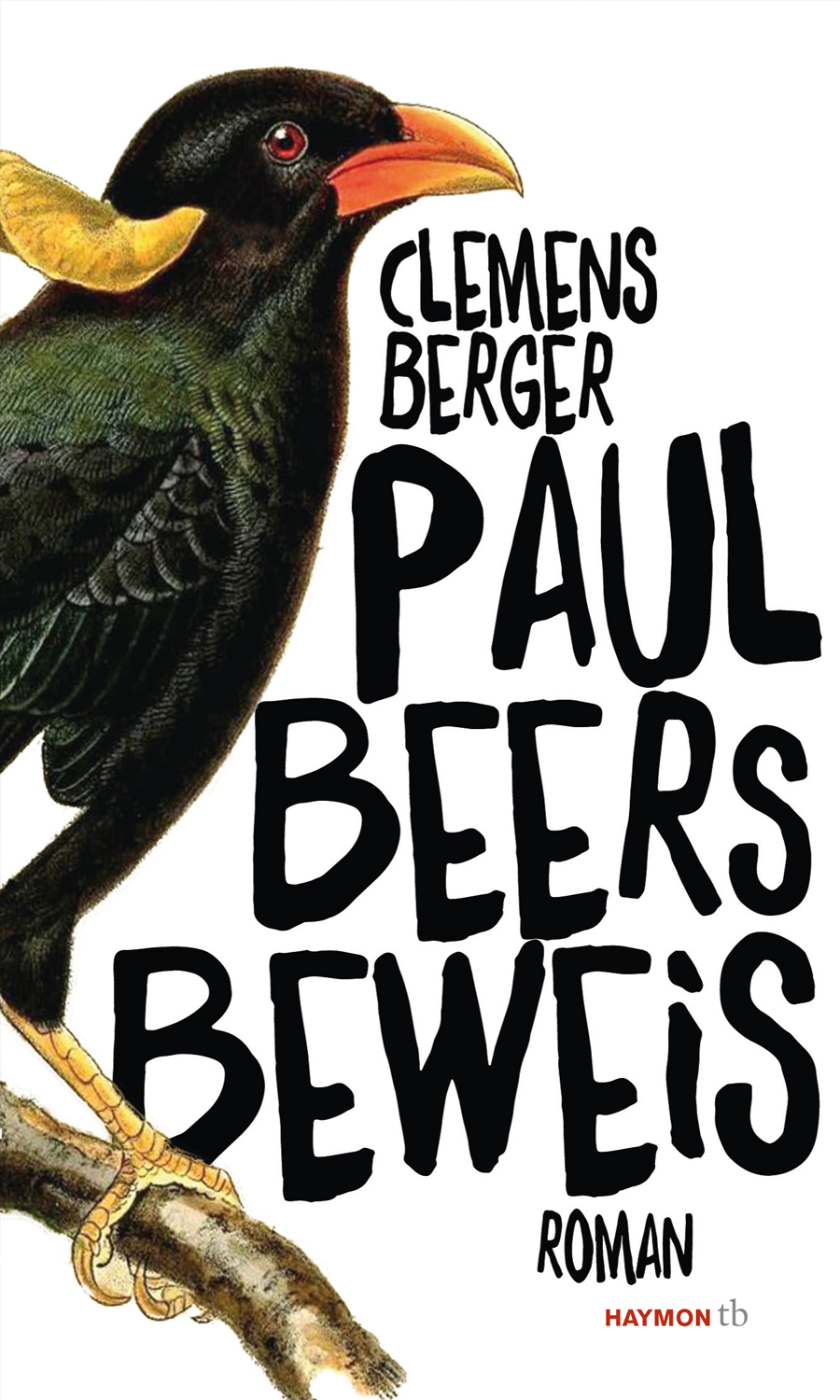Zu den wichtigsten ProtagonistInnen:
Franz Schwarz ist ein AMS-Fall, er belegt einen „Besserungskurs für Nutzlose“. Ist ehemaliger Setzer, Hausbesitzer, Ehemann und nunmehriger Fußballfan und Kneipenbesucher.
Franz Schwarz erwachte nach dem Umschulungskurs, den er wie eine Tortur über sich hatte ergehen lassen. Vorne setzte die Leiterin fort, wo er in der Einheit zuvor schon nachgehinkt war, und jeder neue Schritt war mit der Qual verbunden, sich als Idiot zu entpuppen oder endgültig den Anschluß an den einzigen Zug zu verpassen, der aus dem Gerade-noch-über-die-Runden-Kommen Richtung Rundenschmeißen fuhr. Nur jedes Mal, wenn er den Raum verließ, verließ er mit ihm auch diese Gedanken. (S. 66)
Der Privatgelehrte Paul Beer verirrt sich in die Stammkneipe Franzens und schenkt diesem vermehrt sein Ohr. Paul will die ehemalige Umgebung von Franz kennen lernen, lässt sich auf seine Geschichte ein.
Ursula Steiner, die Antiquarin, sucht gerne Sätze, um sie dann in gestelzter Konversation anbringen zu können. „Reisen konnte sie und lesen.“ Früher auch noch kiffen (an diese Zeit erinnert sie ein Treffen mit der Studienkollegin und nunmehrigen frustrierten Lehrerin Sabine). Paul ist Ursulas Lieblingskunde und -gesprächspartner. Dieses gegenseitige betexten mit Angelesenem, dieses befloskeln und zudecken mit Zitaten ist für den Leser recht mühsam.
Vielleicht sollte er ihr das Duwort anbieten. Sie setzten sich wieder, Beer, Tisch, Steiner, stießen die Gläser gegeneinander, wünschten einander Wohl, die Früchte vom Baum des Lebens, den Kommunismus, das innere Glück, die Erleuchtung und dergleichen mehr. Eine Zeitlang saßen sie einfach nur nebeneinander. (S. 121)
Dass Ursula und Paul nach ihrem ersten gemeinsamen Abendessen (welche Monologe!) weitere Treffen folgen lassen, ja sich schließlich gar finden, ist kaum zu glauben, sei ihnen aber von Herzen gegönnt. Einige der Konversationen hätte man sich aber sparen können. Man erfährt darin nämlich weder Wichtiges über die Figuren noch unbedingt Wissenswertes aus der Geisteswelt. Zudem kommen die Erläuterungen zuweilen ziemlich altklug daher.
Die Story an sich ist aber gut, die verträgt auch diesen Dialogballast. Schade ist’s halt. Denn der Gesamteindruck wird dadurch doch merklich getrübt.
Dann ist da noch Manfred der Wirt mit Vogel Fritz (der in Italien gewonnen wurde und gottlob weniger spricht als alle anderen) sowie Rainer der Lebemensch, der eine zentrale Rolle in der Geschichte spielt. Welche, das sei hier nicht verraten, denn die Spannung und die geschickte Romankonstruktion entschädigen für die ertragenen Belehrungen. Und am Schluss lassen sich sowohl der Erzähler als auch Paul gar ein wenig treiben und belohnen die Lesenden bzw. die Antiquarin mit einer schön fabulierten Geschichte.
Literatur, der man das jugendliche Alter des Machers – Clemens Berger ist Jahrgang 1979 – nicht anmerkt, die für eine breite Leserschicht geeignet ist und hoffentlich auch gebührend viele LeserInnen erreicht.