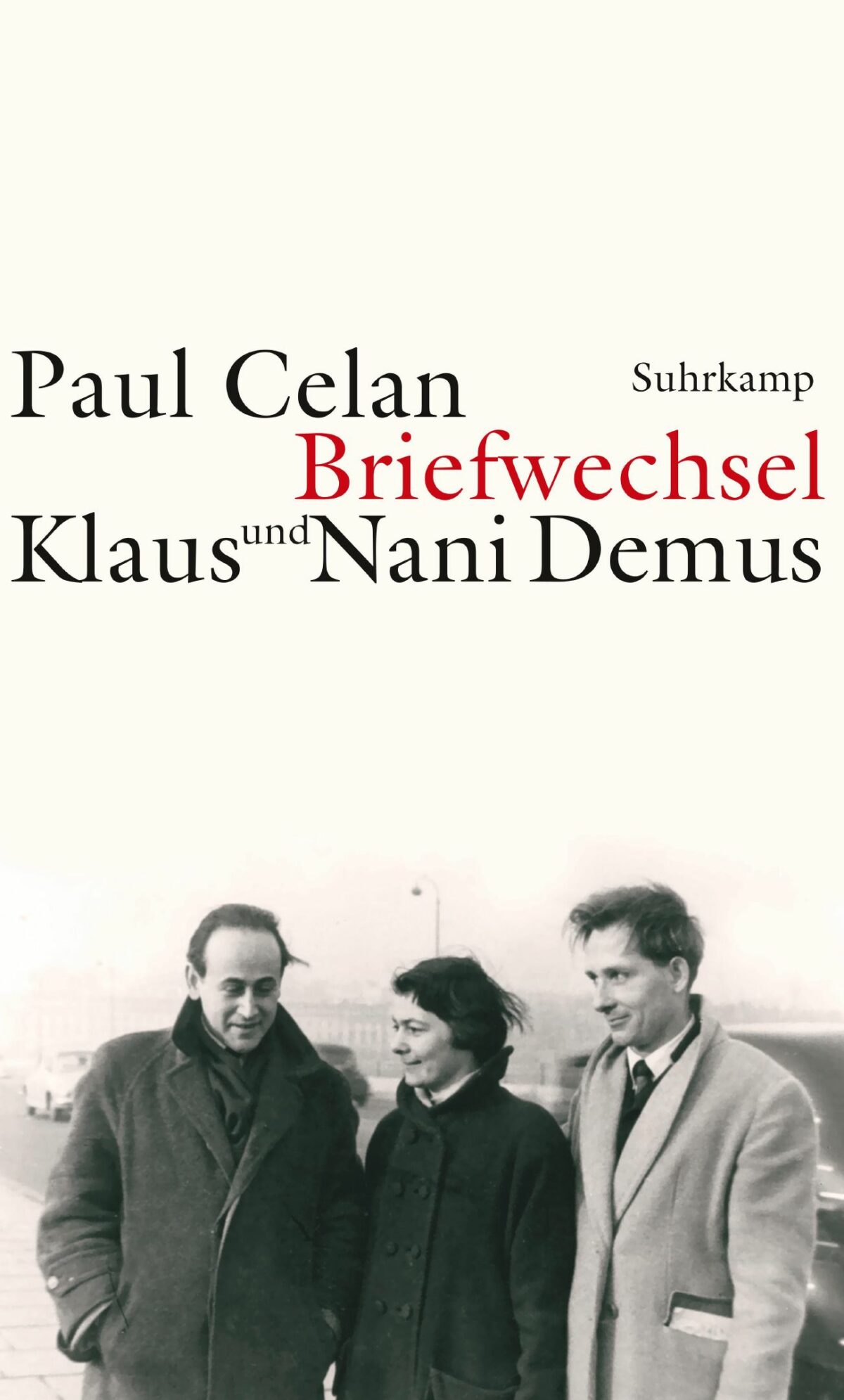1949 schreibt er Celan: „Ich denke so sehr an Sie, wie an eine Person im Traum.“ Zugleich stehe der Abwesende „nun ganz wirklich an der Stelle in meinem Denken, die für ein Idol da ist. Ein Standbild, zu dem meine Vögel kommen dürfen.“ Von Anfang, von der ersten Publikation in Otto Basils Zeitschrift „Plan“ an, hat Demus das Besondere der Celanschen Gedichte erkannt und bewundert: „Gemacht um zu dauern, außer Ihnen, nach Ihnen, ohne Sie. Durch die unbeschreiblich traurige Melodie.“ Von dem Drang zur Nachahmung konnte Demus sich bald befreien, die Bewunderung blieb. Solange bis Celans Gedichte immer fragmentarischer, enigmatischer, dunkler wurden: Mit dem Band „Die Niemandsrose“ (1963) war das Ende der literarischen Loyalität besiegelt, Demus behielt das Ausmaß seiner Vorbehalte jedoch für sich. Das meint sein Satz von der Unaufrichtigkeit als Schuld. Bisher hatte der Jüngere sehr wohl Kritik an Details geübt, auf Celans Bitte hin bisweilen auch Korrekturvorschläge, etwa für dessen Übersetzungen, gemacht. Daß Demus ihm seinen grundlegenden Dissens nicht offenbarte, hatte mit Celans großer Wunde zu tun, der sogenannten Goll-Affäre: Der wider besseres Wissen erhobene Plagiatsvorwurf der Witwe Iwan Golls beherrschte ab 1956 Paul Celans Denken und Fühlen, seine Korrespondenz wie sein lyrisches Werk. Der jüdische Dichter aus Czernowitz, dessen Eltern im SS-Arbeitslager umgekommen waren, empfand die Attacke als Rufmord und somit als Angriff auf Leib und Leben. In seinen Augen lieferte die Jüdin Claire Goll den deutschen Antisemiten willkommene Munition. Klaus Demus und seine Celan nicht minder zugetane Ehefrau Nani ergriffen im jahrelangen Feuilletonstreit (wie übrigens auch der österreichische P.E.N.) die Partei des Freundes, sie trösteten ihn geduldig und sahen doch zugleich – wie Ingeborg Bachmann – daß die Affäre Celans Gemüt zerrüttete, die Ehe mit seiner Frau Gisèle schwer belastete und sein Argwohn selbst gegen die engsten Mitstreiter paranoide Züge annahm.
So wurde ab einem gewissen Zeitpunkt jede literarische Kritik zu einer Kritik der ganzen Person. Immerhin tadelt Klaus Demus einmal ein Gedicht („Eine deutsche Weise“) als „Polemik, verallgemeinert, doch nicht objektiviert“. Eine grundlegende Infragestellung des Spätwerks wagt er nicht, ebenso wenig ein offenes Wort zu Celans immer obsessiverer Beschäftigung mit den Auswirkungen der Causa Goll. Erst 1962 entscheidet Demus sich, dem Freund in einem liebevoll besorgten Brief „das Äußerste, das Allerletzte“ zu sagen: Eine persönliche Begegnung in Paris hat seinen Verdacht bestärkt, Celan sei an Paranoia erkrankt. Als Freundespflicht versteht Demus diesen Brief und bittet Celan, sich in ärztliche Behandlung zu begeben; der faßt ihn als Affront auf, schweigt von nun an. Und obwohl die Entwicklung Demus recht gibt – Celan wird nach psychotischen Schüben und lebensgefährlichen Angriffen auf seine Frau mehrmals stationär aufgenommen – wartet Celan auf eine Entschuldigung des allzu Aufrichtigen, die dieser nach sechs Jahren (und ohne von alldem zu wissen) auch liefert.
So ist der tadellos edierte und mit einem detaillierten Kommentar ausgestattete Band das rührende Dokument einer Freundschaft, in die auch die Frauen der Dichter miteinbezogen sind (Gisèle Celan-Lestranges Briefe sind auf französisch und in deutscher Übersetzung beigefügt). Er zeigt einen kaum bekannten Wiener Lyriker als hingebungsvollen Briefschreiber, der bald poetisch, bald intellektuell analytisch, bald ungeschützt persönlich das schriftliche Gespräch mit dem fernen Freund sucht. In seinen Briefen erscheint Klaus Demus schwärmerisch und warmherzig, klug und – es gibt kein treffenderes Wort – lauter.
So sehr man über Demus‘ selbstlose Zärtlichkeit ins Staunen gerät, so sehr erschrickt man über die schneidende Kälte, die Paul Celan zu Gebote stand, wenn er verletzt war. Der Eindruck, der sich beim Lesen der Bachmann-Korrespondenz aufdrängt, wird hier bestätigt: Seine Freunde hatten es mit Celan nicht leicht. Er scheute nicht den Gestus des Auserwählten, er verlangte besondere Rücksicht, ohne sie selbst zu gewähren, war auch eifersüchtig auf den Erfolg der jüngeren Dichterin. Dabei war er, wie Demus dem Herausgeber berichtete, im Umgang mit den vertrauten Freunden von einer bestrickenden Präsenz und Intensität – bis zu seiner psychischen Krise und Erkrankung. „Ihr seid meine endlich wirklich gewordene Welt“, schreibt der Heimatlose, der im Winter 1947 als „Displaced Person“ nach Wien kam, sich später als österreichischer Dichter und französischer Staatsbürger verstand, an Nani und Klaus Demus: „ich weiß unter meinen Freunden niemand, der mir so nahe wäre wie Ihr“.
Die 380 hier versammelten Briefe und Karten beweisen auch, wie das halbe Jahr, das Celan in Wien verbrachte (wo 1948 sein Erstling „Der Sand aus den Urnen“ erschien), in seine zunächst von bitterer Armut geprägte Pariser Zeit, in sein ganzes Leben fortwirkte, nicht nur in der Person Ingeborg Bachmanns, die ihre Schulfreundin Nani Maier und deren damaligen Verlobten Klaus Demus mit dem hochbegabten jungen Mann aus der Bukowina zusammengebracht hatte. In der einstigen Haupt- und Residenzstadt knüpfte Celan Kontakte zum Kreis der Surrealisten, auch zu bildenden Künstlern wie Edgar Jené. Der Kunsthistoriker Demus, der im alles andere als aufgeschlossenen Nachkriegswien eine Lanze für die zeitgenössische Kunst brach und später in der Österreichischen Galerie des Belvedere und im Kunsthistorischen Museum arbeiten sollte, war ihm da ein kongenialer Gesprächspartner. Von einer nicht nur physischen Nähe zum „Surrealismus“ (der in Wien damals als Synonym für alles provokant Moderne stand) wollten freilich beide Dichter später nichts wissen: Demus, weil er seine Lyrik schon früh auf das Vorbild der klassischen Hymne hin orientiert hatte, Celan wohl auch deshalb, weil er im Gefolge der Goll-Affäre das Eigene betont und jede Affinität zu (französischen) Schulen vermieden wissen wollte.
Von Literatur ist in den Briefen der Freunde durchaus ausführlich die Rede, sie empfehlen einander Bücher, sie tauschen eigene Gedichte aus, kommentieren das Gelesene. Wie in der Korrespondenz mit Ingeborg Bachmann ist Celan der säumigere, der wortkargere Briefpartner. Demus, der noch 1952 bekannt hat, Joyces „Finnegans Wake“ „wie ein Brevier zu lesen“, deklariert sich ästhetisch immer entschlossener als Konservativer. Über das stickige Wiener Kulturklima der Fünfziger berichtet er wie einer, den es nichts angeht. Mit seiner literarischen Außenseiterrolle hat er sich zwar offenbar arrangiert, die Zweifel an der eigenen Berufung zum Dichter machen ihm aber zu schaffen. Celans Gedichte betrachtet Demus, der in seinen Briefen darüber Schönes und Prägnantes zu sagen weiß, lange nicht als ein Aufbegehren gegen die Sprache, sondern als die einzige zeitgemäße Fortschreibung der Tradition: „Weit und breit bist Du, Paul, der Einzige, der sie leistet in der dürftigen Zeit, der einzige Sachwalter des deutschen Gedichts, der deutschen Sprache.“
Irgendwie ist es tröstlich, daß es dem Ehepaar Demus gelang, diesen Ton bedingungsloser Verehrung nach dem Bruch wieder aufzunehmen, eindrucksvoll im letzten Brief Nanis vom 16. April 1970, der Celan wohl noch erreichte und in dem die Literaturwissenschaftlerin zu begreifen sucht, was ihrem Mann (in ästhetischer Hinsicht) verschlossen blieb: „Dein Dasein, Deine Existenz als Leidender, Fühlender, als Denkender, der es zu äußern vermag, wie kein anderer in dieser bitteren Zeit, mit den vorgetriebensten Organen, dem lebendigsten Puls, was nicht mehr faßbar ist mit Worten und auch darüber hinaus hineinragen will in ein Kommendes“.