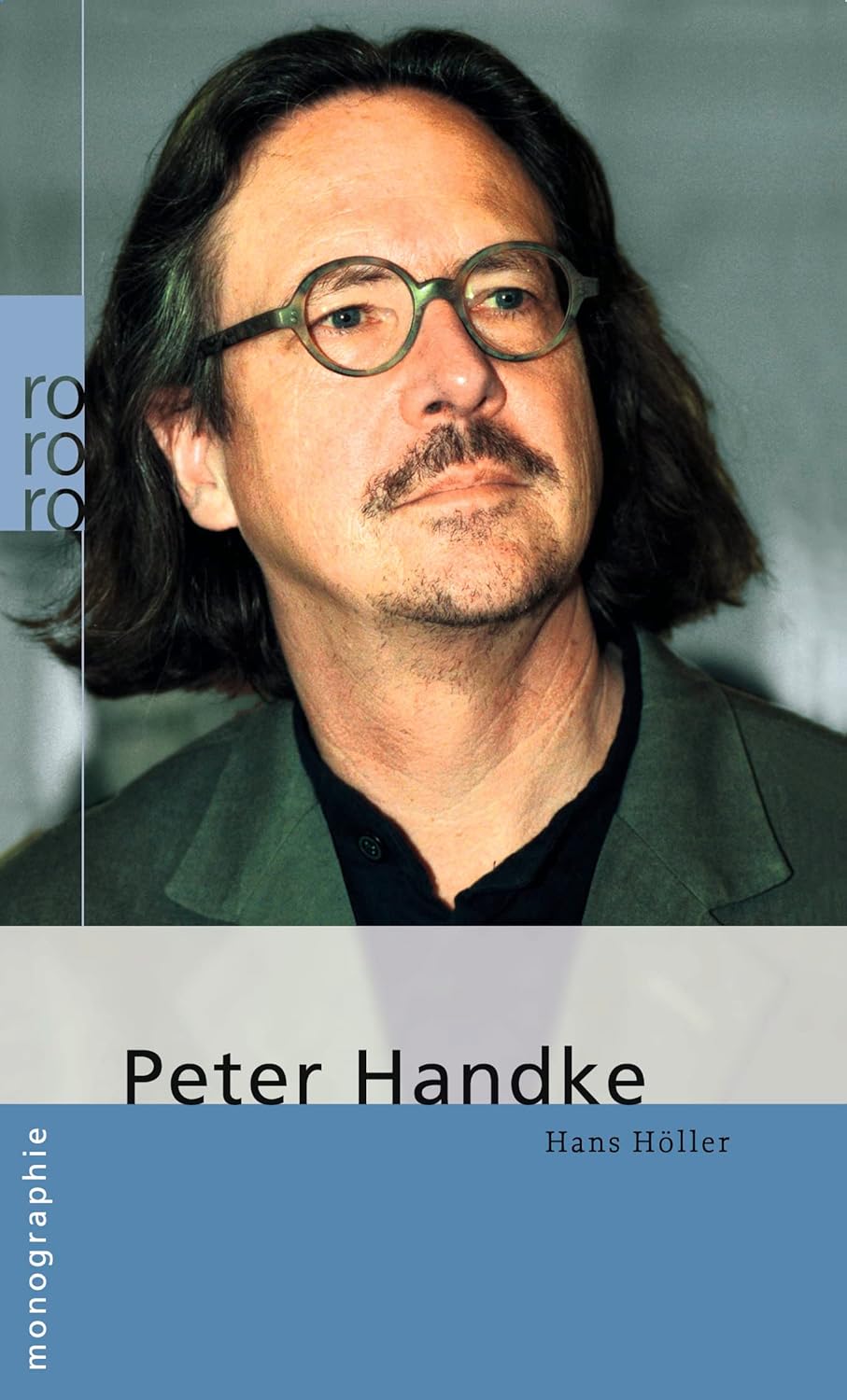Auf knapp über 100 Textseiten ein Schriftstellerleben abzuhandeln und dabei noch interpretatorisch Neues und Spannendes zu bringen, ist keine Kleinigkeit. Nur „wie und warum“ Partnerschaften im Leben Peter Handkes ihren Anfang und ihr Ende gefunden haben, bleibt hier „ausgespart, unerforscht, oder genauer: […] wird nicht ausgekundschaftet“ (S. 109). Das ist eine Haltung, die heute einem Biographen oft schlecht honoriert wird, schließlich ist auch das literarisch geschulte Lesepublikum an die Junkkost der Homestorys gewöhnt. In einem Interview in Ö1 wurde der Autor prompt gefragt, wie sich Peter Handke ihm gegenüber verhalten habe und wie er denn so sei. Mit entwaffnender Offenheit antwortete Höller, er sei viel zu ehrfurchtsvoll gewesen, um hier viel zu fragen oder gar ein Urteil zu fällen. Man hätte Peter Handke tatsächlich keinen besseren Biographen wünschen können.
Was das vorliegende Buch zeigt, ist die politische Grundierung von Handkes gesamtem Werk. Höller wählt als Einstieg einen Traumbericht des jungen Handke, niedergeschrieben 1963 in einem Brief an seine Mutter; er handelt von deren im Zweiten Weltkrieg gefallenem Bruder, Handkes Onkel Gregor. Es gibt auch einen Onkel, der ein offenbar strammer FPÖler wurde, doch es ist und bleibt Onkel Gregor mit den slowenischen Wurzeln, der den Schriftsteller Handke umtreibt, gemeinsam mit der Verstörung durch Nationalsozialismus, Krieg und Nachkriegszeit. Dass er dabei immer schon seinen ganz eigenen Ton bewahrt hat und jeden zu einlässigen oder zu eindeutigen Ton vermieden hat, so macht diese Sicht auf Handkes Lebenswerk verständlich, ist wohl mit einer der zentralen Gründe für die Missverständnisse rund um Handkes missglücktes Engagement für das untergegangene Jugoslawien. Ein „Bewohner des Elfenbeinturms“ ist hier rasch ins argumentative Abseits gestellt.
Beeindruckend sind die vielen kleinen Schnittstellen, die hier zwischen Leben bzw. gesellschaftlicher Realität und Werk sichtbar oder neu bewertet werden: Wie Handke Onkel Gregor immer wieder auftauchen lässt und näher an sich heranrückt – etwa als in Slowenien (hier besuchte der Onkel die Obstbauschule) verschollener Bruder in der „Wiederholung“; wie in „Himmel über Berlin“ die Kinderjahre bei der Familie des Stiefvaters durchscheinen; wie die Autobuserlebnisse des Fahrschülers eine lebenslange Prägung werden; aber auch, wie Handkes raumbezogenes Denken und Schreiben mit Spinoza zu tun hat und welche Spuren Walter Benjamins zu finden sind.
Als Hans Höller sein Buch abschloss, war „Die morawische Nacht“ noch nicht erschienen. Dass er richtig liegt mit seinen in der Kindheit des Autors festgezurrten Themenketten, ist auch diesem bislang letzten Roman deutlich eingeschrieben. Wer ein halbes Jahrhundert später noch die Wäschenummer seiner Tanzenberger Internatszeit präsent hat, in dem hat diese tatsächlich viel mehr unauslöschliche Spuren hinterlassen als die saloppe Selbstpräsentation vermuten ließ, mit der Handke seine Karriere startete. Debüts waren damals noch selten ein Event, weshalb man bei Handke gerne von einem „kometenhaften“ Aufstieg spricht. „Herr Peter Handke, reizvoll mädchenhaft anzusehen, so befangen wie keck, trat unlängst in Wien vor eine Zuhörermenge und las aus seinen Werken vor“, schrieb Hilde Spiel 1967, die mächtig empörte, dass Handke dabei ein Fake von Anselm Feuerbach eingebaut hatte. Über so ein „Happening, eine Eulenspiegelei ohne tieferen Sinn“, konnte man sich damals noch so richtig entrüsten.
Was in der Werküberschau auch deutlich wird, ist die Tatsache, dass Handke – ohne auf sie zu schielen – der Zeitstimmung nicht selten eine Nasenlänge voraus war und zu einer Art Trendsetter wurde. Hat er von der „Publikumsbeschimpfung“ (1966) bis zum „Ritt über den Bodensee“ (1970) gewissermaßen noch die sprach- und formkritischen Ansätze der Zeit aufgegriffen und mit seiner Adaption von Erzählmodellen („Die Hornissen“, 1966, „Der Hausierer“, 1967) weiterentwickelt, kommt der „Angst des Tormanns beim Elfmeter“ (1969) schon eine Vorreiterrolle zu. Zwar ist auch dieses Buch noch als Spiel mit dem Modell „Roman“ zu verstehen, aber Reflexion auf Sprache, Wirklichkeitsdarstellung und literarische Form wird hier nicht mehr explizit thematisiert, sondern findet sich integriert in Figurenreflexion. „Der kurze Brief zum langen Abschied“ (1972) nutzt dann den Rekurs auf Reiseliteratur – wie einige Jahre später Peter Rosei oder Gerhard Roth – als Hebel zur Rückkehr zu einlässigem Erzählen. „Wunschloses Unglück“ (1972) schließlich eröffnet die endlose Reihe der österreichischen Dorfromane genauso wie die Wiederentdeckung der Familiengeschichten, während Handke mit den „Versuchen“ dann die Tendenz zur literarischen Kleinform vorwegnimmt.
Ein Aspekt, der vielleicht einmal stärker anvisiert werden sollte, ist Handkes Fähigkeit zu Selbstironie, zu Distanzierung und zum lustvollen Unterlaufen der vordergründigen Ernsthaftigkeit. „Don Juan (erzählt von ihm selbst)“ oder „Die morawische Nacht“, aber auch schon die „Journale“ lassen vermuten, dass sich eine Relektüre von Handkes Gesamtwerk unter diesem Aspekt lohnen würde.